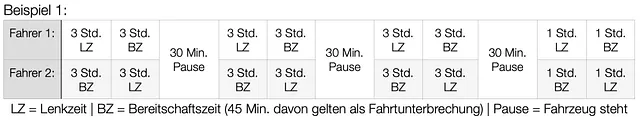Berufskraftfahrer — BUS & LKW
Siehe auch Spezialwissen Bus / LKW
Hier findest du Informationen zum fahren mit Bus und LKW auf europäischen Strassen. D.h. Strassenverkehrsregeln, Lenk- und Ruhezeiten, Tachovorschriften, und vieles mehr, was dich im Strassenverkehr betrifft.
-
Umrüstungpflicht Smart Tacho 2
Ab dem 19. August 2025 müssen alle grenzüberschreitend eingesetzten LKW und Busse mit einem Smart-Tacho der Generation 2 ausgestattet sein. Dies stellt insbesondere für österreichische Frachtführer ein grosses Problem dar, da viele innerösterreichische Transporte über das „deutsche Eck“ oder das „italienische Eck“ führen.
Das „deutsche Eck“ bezieht sich nicht nur auf den Autobahnkorridor von Salzburg nach Kufstein, sondern umfasst auch alle Fahrten, die von Oberösterreich oder Salzburg nach Tirol und Vorarlberg führen. Des Weiteren gibt es das „italienische Eck“, das Transporte von Tirol nach Osttirol über italienisches Territorium betrifft.
Der Vorteil der neuen Generation von Tachografen besteht darin, dass sie Grenzübergänge automatisch speichern (bei VDO erfolgt dies nur, wenn eine Fahrerkarte verwendet wird, die nach August 2023 ausgestellt wurde). Allerdings vergessen viele Fahrer, die über ein solches Gerät verfügen, dass sie gemäss der Verordnung dem Tachografen die Be- / Entladeladestelle mitteilen müssen. Dieser speichert dann die Koordinaten.
Diese Regelung wurde von der EU eingeführt, um den Kabotageverkehr zu unterbinden. Wenn ein Fahrer dies unterlässt, kann es zu einer Anzeige wegen Nichtbedienung des digitalen Tachografen kommen.
Als Fahrer findet man den Menüpunkt Be-/ Entladen auf folgende Weise:
Beim VDO-Tachograf geht man wie folgt vor:
- Drücke die „OK“-Taste.
- Blättere nach unten, bis zum den Menüpunkt „Eingabe Fahrzeug“, und bestätigemit „OK“.
- Blättere weiter nach unten bis der Menüpunkt „Be-/Entladen“ erscheint.
- Wähle diesen Punkt aus und blättere dann zur richtigen Tätigkeit, um diese erneut zu quittieren.
Beim Stoneridge-Tachograf verfahre bitte folgendermassen:
- Drücke die „OK“-Taste.
- Blätter einmal nach unten zum Menüpunkt „Orte“ und bestätige mit „OK“.
- Blätter dann einmal nach oben zur Eingabe „Be- oder Entladen“ und wähle diesen Punkt aus.
- Jetzt entscheide, ob Be- oder Entladen oder beides gewählt werden soll und bestätige dies durch drücken der entsprechenden "Pfeil" oder “OK” Taste drücken
Diese Eingabe muss vom Fahrer durchgeführt werden um Art. 8 Abs. 1 der geltenden Fassung der VO165/2007 umsetzen zu können:
„(1) Um die Uberprüfung der Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften zu erleichtern, wird der Standort des Fahrzeugs an folgenden Punkten oder am nächstgelegenen Ort, an dem das Satellitensignal verfügbar ist, automatisch aufgezeichnet:
- Standort zu Beginn der täglichen Arbeitszeit;
- jedes Mal, wenn das Fahrzeug die Grenze eines Mitgliedstaats überschreitet;
- bei jeder Be- oder Entladung des Fahrzeugs; => Der Tachograf kann nicht wissen, ob Be- oder Entladen wird – deswegen muss der Fahrer dies dem Tacho durch die Eingabe mitteilen.
- nach jeweils drei Stunden kumulierter Lenkzeit und _ Standort am Ende der täglichen Arbeitszeit.
Um die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften durch die Kontrollbehörden zu erleichtern, zeichnet der intelligente Fahrtenschreiber gemäss den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ferner auf, ob das Fahrzeug für die Beförderung von Gütern oder Personen benutzt wurde.
-
Halteplatzklausel
Diese Regelungen für Abweichungen von den Lenk- und Ruhezeiten sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ein Fahrer darf die tägliche und wöchentliche Lenkzeit überschreiten oder die Ruhezeiten unterschreiten, um zu einem geeigneten Halteplatz zu gelangen um dort eine Ruhezeit einzulegen.
Dabei darf er folgende Artikel der Verordnung über- oder unterschreiten:
- Artikel 6
- ABS 1:
Die tägliche Lenkzeit darf 9 Stunden nicht überschreiten. Die tägliche Lenkzeit darf jedoch höchstens zweimal in der Woche auf höchstens 10 Stunden verlängert werden. - Abs 2:
Die wöchentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten und nicht dazu führen, dass die in der Richtlinie 2002/15/EG festgelegte wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten wird. - Abs. 3:
Die summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander folgender Wochen darf 90 Stunden nicht überschreiten.
- ABS 1:
- Artikel 7:
Nach einer Lenkdauer von viereinhalb Stunden hat ein Fahrer eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung von wenigstens 45 Minuten einzulegen, sofern er keine Ruhezeit einlegt.
Diese Unterbrechung kann durch eine Unterbrechung von mindestens 15 Minuten, gefolgt von einer Unterbrechung von mindestens 30 Minuten, ersetzt werden, die in die Lenkzeit so einzufügen sind, dass die Bestimmungen des Absatzes 1 eingehalten werden. - Artikel 8
- Abs. 2:
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit muss der Fahrer eine neue tägliche Ruhezeit genommen haben.
Beträgt der Teil der täglichen Ruhezeit, die in den 24-Stundenzeitraum fällt, mindestens 9 Stunden, jedoch weniger als 11 Stunden, so ist die fragliche tägliche Ruhezeit als reduzierte tägliche Ruhezeit anzusehen.” - Abs. 5:
“Ein im Mehrfahrerbetrieb eingesetzter Fahrer innerhalb von 30 Stunden nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit eine neue tägliche Ruhezeit von mindestens 9 Stunden genommen haben.” - Abs 6:
In 4 jeweils aufeinander folgenden Wochen hat der Fahrer mindestens 2 reguläre Ruhezeiten einzuhalten. Diese ,müssen am Standort des Betriebes oder dem Wohnort des Fahrers gemacht werden.
- Abs. 2:
- Artikel 9:
Regelungen über Fähre und Bahnverladung
ERGO: man darf die Lenkzeit sowie Einsatzzeit überschreiten, und die Ruhezeitvorschiften je 24 Stunden unterschreiten damit man zu einem sicheren Halteplatz kommt.
Der Fahrer muss den Grund für die Überschreitung spätestens beim Erreichen des Zielorts oder eines geeigneten Halteplatzes handschriftlich im Schaublatt des analogen Kontrollgerätes, auf einem Ausdruck des digitalen Kontrollgerätes oder im Arbeitszeitplan (im Falle von Personenlinienverkehr ohne Kontrollgerät) vermerken.
- Artikel 6
-
Heimkehrklausel
Diese Regelungen für Abweichungen von den Lenk- und Ruhezeiten sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ein Fahrer darf die tägliche und wöchentliche Lenkzeit überschreiten, um zur Betriebsstätte des Arbeitgebers oder seinen Wohnsitz zu gelangen um dort eine regelmässige wöchentliche Ruhezeit einzulegen:
- Um bis zu 1 Stunde.
- Um bis zu 2 Stunden, vorausgesetzt, dass unmittelbar vor der zusätzlichen Lenkzeit eine ununterbrochene Fahrtunterbrechung von 30 Minuten eingelegt wurde.
Dabei darf er folgende Artikel der Verordnung überschreiten:
- Artikel 6
- Abs. 1:
Die tägliche Lenkzeit darf 9 Stunden nicht überschreiten. Die tägliche Lenkzeit darf jedoch höchstens zweimal in der Woche auf höchstens 10 Stunden verlängert werden. - Abs. 2:
Die wöchentliche Lenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten und nicht dazu führen, dass die in der Richtlinie 2002/15/EG festgelegte wöchentliche Höchstarbeitszeit überschritten wird.
- Abs. 1:
- Artikel 8
- Abs. 2:
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Ende der vorangegangenen täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit muss der Fahrer eine neue tägliche Ruhezeit genommen haben.
Beträgt der Teil der täglichen Ruhezeit, die in den 24-Stundenzeitraum fällt, mindestens 9 Stunden, jedoch weniger als 11 Stunden, so ist die fragliche tägliche Ruhezeit als reduzierte tägliche Ruhezeit anzusehen.
- Abs. 2:
ERGO: Somit darf man zum Zweck der Heimkehr vor der regulären Wochenruhezeit die 9 bzw. 10 Stunden Tageslenkzeit sowie die 56 Stunden Wochenlenkzeit überschreiten und die Einsatzzeit von 13 oder 15 Stunden überschreiten. Aber nur damit man zur regulären Wochenruhezeit (45 Stunden + die zulane gefahrene Zeit) nach Hause kommt.
Der Fahrer muss den Grund für die Überschreitung spätestens beim Erreichen des Zielorts oder eines geeigneten Halteplatzes handschriftlich im Schaublatt des analogen Kontrollgerätes, auf einem Ausdruck des digitalen Kontrollgerätes oder im Arbeitszeitplan (im Falle von Personenlinienverkehr ohne Kontrollgerät) vermerken.
Für jede Verlängerung der Lenkzeit muss ein gleichwertiger Ausgleich durch eine Ruhepause erfolgen, die zusammen mit einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit ohne Unterbrechung bis zum Ende der dritten Folgewoche nach der Verlängerungswoche genommen werden muss.
-
2-Fahrer-Betrieb
Bitte den 2-Fahrer-Betrieb nicht mit Schichtbetrieb verwechseln! Diese Abhandlung gilt nur für den zwei 2-Fahrer-Betrieb, die so genannte Doppelbesatzung, sofern, das ist wichtig, beide Fahrer während der gesamten Einsatzzeit im Fahrzeug sind!
Während der 1. Stunde muss der 2. Fahrer noch nicht im Fahrzeug sein. Dennoch gelten die 21 Stunden Einsatzzeit ab dem Arbeitszeitbegin des 1. Fahrers. Steigt ein Fahrer aus, ist der Mehrfahrerbetrieb nicht mehr gegeben, und die Einsatzzeit ist auf 13 bzw. 15 Stunden beschränkt. Hat der 1. Fahrer bereits mehr als 13 bzw. 15 Stunden Einsatzzeit, muss beim aussteigen des 2. Fahrers das Fahrzeug abgestellt werden und die Ruhezeit erfolgen. Dabei ist es egal, welcher Fahrer zuerst aussteigt.
Beim 2-Fahrer-Betrieb egal, ob im Bus oder im LKW, dürfen die Fahrer 21 Stunden Einsatzzeit haben, gefolgt von einer 9-stündigen Ruhezeit. Unter Berücksichtigung der EU-Verordnungen können die Lenkzeiten der 2 Fahrer bis zu 9 Stunden pro Tag (2 mal pro Woche 10 Stunden) betragen, was längere Fahrten ermöglicht.
Es ist aber auch das Arbeitszeitgesetz von Bedeutung: das bedeutet das nach einer Arbeitszeit von 6 Stunden mindestens 30 Minuten Pause erfolgen müssen. Diese Pause kann nicht während der Fahrt konsumiert werden. Das bedeutet, dass nach einem Wechsel des Fahrers der zweite Fahrer weiter fahren kann bis der erste der beiden Fahrer seine 6 Stunden Arbeitszeit voll hat, dann müssen 30 Minuten Pause gemacht werden. Dabei muss das Fahrzeug stehen und es den Fahrern möglich sein, Toiletten aufzusuchen oder andere wichtige der Erholung dienende Dinge zu tun.
Es empfiehlt sich, im Fall, wenn die 21 Stunden Einsatzzeit ausgenutzt werden sollen alle 3 Stunden den Fahrer zu wechseln und jeweils nach 6 Stunden eine 30-minütige Pause einzulegen.
Siehe Beispiel 1
So hat jeder Fahrer 10 Stunden Lenkzeit ausgenutzt und insgesamt sind es 20.5 Stunden Einsatzzeit.
Natürlich ist zu bedenken, dass es meistens zusätzlich noch Ladetätigkeiten gibt, die durchgeführt werden müssen. Dann reichen in Normalfall 9 Stunden Lenkzeit pro Fahrer mit 1.5 Stunden Pause sowie 1.5 Stunden für Ladetätigkeiten.
-
Schichtbetrieb
Bitte den Schichtbetrieb nicht mit 2-Fahrer-Betrieb verwechseln! Diese Abhandlung gilt nur für den Schichtbetrieb. Dabei ist wichtig, das immer nur ein Fahrer gleichzeitig im Fahrzeug ist!
Beim Schichtbetrieb egal, ob im Bus oder im LKW, werden mehrere Fahrer auf dem gleichen Fahrzeug eingesetzt, welches dadurch 24/7 unterwegs sein kann. Unter Berücksichtigung der EU-Verordnungen kann die Lenkzeiten jedes Fahrer bis zu 9 Stunden pro Tag (2 mal pro Woche 10 Stunden) betragen.
Zur Illustration siehe Beispiel 2.
Natürlich verlangt diese Umsetzung eine gewisse Flottengrösse und das Personal dazu, da es sich sonst nicht ausgeht. Man kann aber auch Varianten verwenden, wo das Auto dazwischen drinnen steht und Mann dadurch mit weniger Personal ausgekommen kann.
Egal welche Variante, wichtig ist, dass der Fahrer dort wo er ist eine Wohnung oder ein Zimmer zur Verfügung hat, und das nächste Fahrzeug wieder in der gleichen Gegend übernimmt. Das ist nicht möglich, wenn ein Fahrer in München aussteigt und seine nächste Schicht in Dortmund beginnt.
-
LASi & technischen Unterwegskontrolle
Hier ist eine überarbeitete Version deines Textes:
Die EU-Kommission hat am 24. April 2025 ein Update der Richtlinie über die technische Straßenkontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die am Straßenverkehr in der EU teilnehmen (2014/47/EU), vorgelegt. Dabei ist eine wichtige Änderung enthalten: Künftig soll in Artikel 13 der Richtlinie stehen:- Bei der technischen Unterwegskontrolle ist an einem Fahrzeug eine Prüfung der Ladungssicherung gemäß Anhang III durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Ladung so gesichert ist, dass der sichere Fahrbetrieb gewährleistet bleibt und keine Gefahr für Leben, Gesundheit, Sachwerte oder die Umwelt besteht. Die Kontrollen sollen prüfen, dass, auch unter allen Einsatzbedingungen des Fahrzeugs, beispielsweise in Notsituationen oder beim Berganfahren,
- Teile der Ladung ihre Lage zueinander sowie zu Fahrzeugwänden oder -oberflächen nur minimal verändern können und
- die Ladung sich nicht aus dem Laderaum herausbewegen oder außerhalb der Ladefläche gelangen kann.
Das bedeutet, dass bei zukünftigen technischen Unterwegskontrollen durch Polizei die Ladungssicherung tatsächlich überprüft werden muss und nicht nur überprüfbar ist wie bisher.
- Bei der technischen Unterwegskontrolle ist an einem Fahrzeug eine Prüfung der Ladungssicherung gemäß Anhang III durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Ladung so gesichert ist, dass der sichere Fahrbetrieb gewährleistet bleibt und keine Gefahr für Leben, Gesundheit, Sachwerte oder die Umwelt besteht. Die Kontrollen sollen prüfen, dass, auch unter allen Einsatzbedingungen des Fahrzeugs, beispielsweise in Notsituationen oder beim Berganfahren,
Spezialwissen BUS
-
Schlbus / Schülertransport
Wissenswertes zum Schulbus
Was sind Schüler im Sinne dieser Regelung?
- schulpflichtige Kinder, zu & von
- einer Schule,
- Schulveranstaltungen und
- Schülerhorten
- Kinder die einen Kindergarten besuchen, zu & von
- einem Kindergarten
- Kindergartenveranstaltungen
- Horten
- schulpflichtigen Zöglingen von Jugendwohlfahrtanstalten, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, von und zu Veranstaltungen dieser Anstalten
Was ist ein Schülertransport?
- Ein Schülertransport ist eine gewerbliche Fahrt mit einem Fahrzeug das Schüler gemäss Punkt A transportiert, ausgenommen im Linienverkehr.
Voraussetzungen für den Busfahrer:
- nicht alkoholisiert (0,1 ‰ Blutalkohol)
- zumindest den Code 95 im Führerschein.
- bis 3.5 t: Führerschein B + Schülertransportausweis
Voraussetzungen Fahrzeug:
- Zusätzlich zu der für jeden Bus vorgeschriebenen Ausrüstung braucht ein Bus mit dem Schülertransporte (ausgenommen Linienbusse) durchgeführt werden zusätzlich
- vorne und hinten am Bus (an der Aussenseite, nicht im Fenster) eine orange Tafel mit dem Zeichen für Kinder www.ris.bka.gv.at
- am Heck des Fahrzeuges zusätzlich eine orange Rundumleuchte oder Blinkanlage gem. ECE 65
Plichten des Lenkers:
- dafür sorgen, dass Kinder bis 14. Lebensjahre die 135 cm und größer sind, auf einem Sitzplatz eines Kraftfahrzeuges, der mit einem Sicherheitsgurt ausgerüstet ist, nur befördert werden, wenn sie den Sicherheitsgurt bestimmungsgemäß gebrauchen.
- dafür sorgen, dass Kinder, ab 3. Jahren, die vorhandenen Sicherheitssysteme (Sicherheitsgurte) benutzen, wenn sie sich auf ihrem Sitzplatz befinden — ausgenommen Linienbus
Wenn eine erwachsene Begleitperson im Omnibus mitfährt, so geht diese Verpflichtung auf diese Person über!
Richtiges Verhalten als Lenker eines Schulbusses
- Orange Schulbus-Tafeln vorne & hinten am (nicht im) Bus anbringen
- Vorsichtig in Haltestellen einfahren wenn Kinder warten (Kinder sind vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Sie können jederzeit losrennen oder sich gegenseitig schubsen)
- Freundlich sein, auch Kinder sind Menschen und Kunden
- Warten, dass sich, gerade die kleineren Kinder, gesetzt haben, bevor man abfährt
- Ausreichend Abstand halten (100 m oder mehr), damit man nicht abrupt bremsen muss
- Wenn Kinder aussteigen darauf achten, dass der Bus nicht überholt wird, wenn Kinder vor dem Bus die Fahrbahn überqueren (entsprechend hinstellen, wenn nötig Hupen)
- schulpflichtige Kinder, zu & von
Spezialwissen LKW
-
Fahrverbotskalender 2025
Für wen :
- Lastkraftwagen oder Sattelkraftfahrzeuge mit einem HzGg. über 7,5 t,
- Lastkraftwagen mit Anhängern, wenn die Summe der HzGg. beider Fahrzeuge über 7,5 t ist.
- Ausgenommen:
- Zielfahrten in der Zeit bis 10 Uhr zum
- Wohnsitz des Lenkers,
- Sitz des Firmenunternehmens,
- Güterterminals,
- LKW-Hofes,
- dauernden Standort des Fahrzeuges oder
- jenem Standort, andem der Unternehmer dem Lenker eine entsprechende Rückfahrtmöglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Firmenkraftfahrzeug bereitstellt.
- oder
- Schlacht- oder Stechvieh,
- Futtermittel und leicht verderbliche Lebensmittel,
- Postsendungen,
- periodische Druckwerke,
- Getränkeversorgung in Ausflugsgebieten,
- Gütern von oder zu Flughäfen
- Unaufschiebbare Belieferung von Tankstellen, gastronomischen Betrieben und Veranstaltungen.
- Reparaturen an Kühlanlagen.
- Abschleppdienst und Pannenhilfe.
- Einsatz in Katastrophenfällen.
- Medizinische Versorgung.
- Einsatz von Fahrzeugen des Straßenerhalters.
- Straßen- oder Bahnbau.
- Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Feuerwehr u. der Müllabfuhr.
- Entsorgung von Abfällen und Betrieb von Kläranlagen.
- Fahrzeuge eines Linienverkehrsunternehmens.
- Unaufschiebbare Fahrten des Bundesheeres bzw. ausländischer Truppen.
- Fahrten von Hilfstransporten anerkannter
- Fahrten der Beleuchter und Beschaller zum
- Fahrten nach Schaustellerart.
- Fahrten i m kombinierten Verkehr Straße-Schiene-Straße oder Straße-Wasser-Straße (vollständig ausgefüllter CIM/UIRR Vertrag muss mitgeführt werden).
- Fahrten, die ausschließlich der Beförderung von Gütern von oder zu Flughäfen oder Militärflugplätzen dienen.
A12 & A13 Richtung Deutschland:
- 18.04.2025 von 00 bis 22 Uhr,
- 03.10.2025 von 00 bis 22 Uhr,
- Ausgenommen:
Fahrten nach Deutschland, wenn sie während des Zeitraumes des Fahrverbotes auf der A12 oder A13 durchgeführt werden und glaubhaft gemacht wird, dass sie von bestehenden Fahrverboten in Deutschland ausgenommen sind.
- Ausgenommen:
A12 & A13 Richtung Italien:
- 19.04.2025 von 11 bis 15 Uhr,
- 25.04.2025 von 11 bis 2 2 Uhr,
- 02.06.2025 von 09 bis 22 Uhr,
- Ausgenommen:
Fahrten nach Italien, wenn sie während des Zeitraumes des Fahrverbotes auf der A12 oder A13 durchführt werden und glaubhaft gemacht wird, dass sie von bestehenden Fahrverboten in Italien ausgenommen sind.
- Ausgenommen:
B 178, B 320,B 177, B 179, B 181, B 182
- An allen Samstagen von 05.07. bis zum 30.08.2025 von 8 bis 15 Uhr, ausserhalb geschlossener Ortschaften
- Ausgenommen:
Fahrten mit Leerfahrzeugen bis 10 Uhr
- Ausgenommen:
A4
- An allen Samstagen von 28.06. bis zum 30.08.2025 von 8 bis 15 Uhr.
- Ausgenommen:
Fahrten mit Leerfahrzeugen bis 10 Uhr
- Ausgenommen:

Gefahrgut allgemein
-
Klasse 1 – Explosive Stoffe und Gegenstände
Die Klasse 1 umfasst folgende Stoffe und Gegenstände:
- Explosive Stoffe: Dazu zählen feste oder flüssige Stoffe (oder Stoffgemische), die durch chemische Reaktionen Gase erzeugen können, die solche Temperaturen, Drücke und Geschwindigkeiten erreichen, dass dadurch Zerstörungen in der Umgebung entstehen können.
Pyrotechnische Sätze: Dies sind explosive Stoffe, mit denen eine Wirkung in Form von Wärme, Licht, Schall, Gas, Nebel oder Rauch – oder einer Kombination dieser Wirkungen – durch nicht detonative, selbstunterhaltende, exotherme chemische Reaktionen erzielt werden soll.- Anmerkung: Stoffe, die selbst keine explosiven Materialien sind, jedoch ein explosionsfähiges Gas-, Dampf- oder Staubgemisch bilden können, fallen nicht unter die Klasse 1. Ebenfalls ausgeschlossen sind wasser- und alkoholhaltige Explosivstoffe, deren Wasser- oder Alkoholgehalt die festgelegten Grenzwerte überschreitet, sowie Explosivstoffe mit Plastifizierungsmitteln – diese gehören der Klasse 3 oder 4.1 an – und explosive Stoffe, die aufgrund ihrer vorherrschenden Gefährlichkeit der Klasse 5.2 zugeordnet sind.
- Gegenstände mit Explosivstoffen: Dies sind Gegenstände, die einen oder mehrere explosive Stoffe oder pyrotechnische Sätze enthalten (z.B. UN 2990).
- Anmerkung: Gegenstände, die explosive Stoffe oder pyrotechnische Sätze in so geringer Menge oder Art enthalten, dass deren unbeabsichtigte oder zufällige Entzündung während des Transports keine nennenswerten Auswirkungen in Form von Splittern, Feuer, Nebel, Rauch, Wärme oder lautem Geräusch verursachen kann, sind von den Vorschriften der Klasse 1 ausgenommen.
- Stoffe und Gegenstände, die nicht in den vorhergehenden Kategorien erwähnt werden und die darauf ausgelegt sind, einen praktischen explosiven oder pyrotechnischen Effekt zu erzeugen.
Zusätzlich gelten im Kontext der Klasse 1 folgende Begriffsbestimmungen:
- Phlegmatisierung: Ein explosivem Stoff wurde ein Stoff (Phlegmatisierungsmittel) zugesetzt, um die Sicherheit bei der Handhabung und dem Transport zu erhöhen. Dieses Mittel macht den explosiven Stoff unempfindlicher oder weniger empfindlich gegenüber Wärme, Stoss, Aufprall, Schlag oder Reibung. Zu typischen Phlegmatisierungsmitteln gehören unter anderem Wachs, Papier, Wasser, Polymere (wie Fluor-Chlor-Polymere) sowie Öle (wie Vaseline und Paraffin).
- Explosiver oder pyrotechnischer Effekt: Eine Wirkung, die durch selbstunterhaltende, exotherme chemische Reaktionen erzeugt wird. Dies umfasst Effekte wie Stoss, Luftdruck, Zertrümmerung, Splitter, Wärme, Licht, Schall, Gas und Rauch.
Beschreibung der Unterklassen
- Unterklasse 1.1: Stoffe und Gegenstände, die massenexplosionsfähig sind. (Eine Massenexplosion ist eine Explosion, die nahezu die gesamte Ladung praktisch gleichzeitig erfasst.)
- Unterklasse 1.2: Stoffe und Gegenstände, die die Gefahr der Bildung von Splittern, Spreng- und Wurfstücken aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind.
- Unterklasse 1.3: Stoffe und Gegenstände, die eine Feuergefahr besitzen und die entweder eine geringe Gefahr durch Luftdruck oder eine geringe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke oder durch beides aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind,
- bei deren Verbrennung beträchtliche Strahlungswärme entsteht oder
- die nacheinander so abbrennen, dass eine geringe Luftdruckwirkung oder Splitter-, Sprengstück-, Wurfstückwirkung oder beide Wirkungen entstehen.
- Unterklasse 1.4: Stoffe und Gegenstände, die im Falle der Entzündung oder Zündung während der Beförderung nur eine geringe Explosionsgefahr darstellen. Die Auswirkungen bleiben im Wesentlichen auf das Versandstück beschränkt, und es ist nicht zu erwarten, dass Sprengstücke mit grösseren Abmessungen oder grösserer Reichweite entstehen. Ein von aussen einwirkendes Feuer darf keine praktisch gleichzeitige Explosion des nahezu gesamten Inhalts des Versandstückes nach sich ziehen.
- Unterklasse 1.5: Sehr unempfindliche massenexplosionsfähige Stoffe, die so unempfindlich sind, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zündung oder des Überganges eines Brandes in eine Detonation unter normalen Beförderungsbedingungen sehr gering ist. Als Minimalanforderung für diese Stoffe gilt, dass sie beim Aussenbrandversuch nicht explodieren dürfen.
- Unterklasse 1.6: Extrem unempfindliche Gegenstände, die nicht massenexplosionsfähig sind. Diese Gegenstände enthalten überwiegend extrem unempfindliche Stoffe und weisen eine zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Zündung oder Fortpflanzung auf.
- Anmerkung: Die von Gegenständen der Unterklasse 1.6 ausgehende Gefahr ist auf die Explosion eines einzigen Gegenstandes beschränkt.
Verträglichkeitsgruppen der Stoffe und Gegenstände
- A Zündstoff
- B Gegenstand mit Zündstoff und weniger als zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen. Eingeschlossen sind einige Gegenstände, wie Sprengkapseln, Zündeinrichtungen für Sprengungen und Anzündhütchen, selbst wenn diese keinen Zündstoff enthalten
- C Treibstoff oder anderer deflagrierender explosiver Stoff oder Gegenstand mit solchem explosiven Stoff
- D Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff, jeweils ohne Zündmittel und ohne treibende Ladung, oder Gegenstand mit Zündstoff mit mindestens zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen
- E Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff ohne Zündmittel mit treibender Ladung (andere als solche, die aus entzündbarer Flüssigkeit oder entzündbarem Gel oder Hypergolen bestehen)
- F Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff mit seinem eigenen Zündmittel, mit treibender Ladung (andere als solche, die aus entzündbarer Flüssigkeit oder entzündbarem Gel oder Hypergolen bestehen) oder ohne treibende Ladung
- G Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff oder Gegenstand mit sowohl explosivem Stoff als auch Leucht-, Brand-, Augenreiz- oder Nebelstoff (außer Gegenständen, die durch Wasser aktiviert werden oder die weissen Phosphor, Phosphide, einen pyrophoren Stoff, eine entzündbare Flüssigkeit oder ein entzündbares Gel oder Hypergole enthalten)
- H Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch weissen Phosphor enthält
- J Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch entzündbare Flüssigkeit oder entzündbares Gel enthält
- K Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch giftigen chemischen Wirkstoff enthält
- L Explosiver Stoff oder Gegenstand mit explosivem Stoff, der eine besondere Gefahr darstellt (z. B. wegen seiner Aktivierung bei Zutritt von Wasser oder wegen der Anwesenheit von Hypergolen, Phosphiden oder eines pyrophoren Stoffes) und eine Trennung jeder einzelnen Art erfordert
- N Gegenstände, die überwiegend extrem unempfindliche Stoffe enthalten
- S Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, dass jede durch nicht beabsichtigte Reaktion auftretende gefährliche Wirkung auf das Versandstück beschränkt bleibt, ausser das Versandstück wurde durch Brand beschädigt; in diesem Falle müssen die Luftdruck- und Splitterwirkung auf ein Mass beschränkt bleiben, dass Feuerbekämpfungs- oder andere Notmassnahmen in der unmittelbaren Nähe des Versandstückes weder wesentlich eingeschränkt noch verhindert werden.
- Anmerkung:
- Jeder Stoff oder Gegenstand in einer spezifizierten Verpackung darf nur einer Verträglichkeitsgruppe zugeordnet werden. Da das Kriterium der Verträglichkeitsgruppe S empirischer Natur ist, ist die Zuordnung zu dieser Gruppe notwendigerweise an die Versuche zur Zuordnung eines Klassifizierungscodes gebunden.
- Gegenstände der Verträglichkeitsgruppen D und E dürfen mit ihren eigenen Zündmitteln versehen oder mit ihnen zusammengepackt werden, vorausgesetzt, die Zündeinrichtung enthält zumindest zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen, um die Auslösung einer Explosion im Falle einer nicht beabsichtigten Reaktion des Zündmittels zu verhindern. Solche Gegenstände und Versandstücke sind der Verträglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.
- Gegenstände der Verträglichkeitsgruppen D und E dürfen mit ihren eigenen Zündmitteln, welche nicht zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen enthalten, zusammengepackt werden (d. h. Zündmittel, die der Verträglichkeitsgruppe B zugeordnet sind), vorausgesetzt, sie entsprechen der Vorschrift für die Zusammenpackung MP21 in Abschnitt 4.1.10. Solche Versandstücke sind der Verträglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.
- Gegenstände dürfen mit ihren eigenen Anzündmitteln versehen oder mit ihnen zusammengepackt werden, vorausgesetzt, die Anzündmittel können unter normalen Beförderungsbedingungen nicht ausgelöst werden.
- Gegenstände der Verträglichkeitsgruppen C, D und E dürfen zusammengepackt werden. Solche Versandstücke sind der Verträglichkeitsgruppe E zuzuordnen.
- Anmerkung:
Gefahren, die aus Klasse 1 resultieren:
Gefahrgut der Klasse 1, das explosive Stoffe und Gegenstände umfasst, birgt verschiedene Gefahren, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Die wichtigsten Gefahren sind:
- Explosion: Die Hauptgefahr von Stoffen der Klasse 1 besteht darin, dass sie explosionsfähig sind. Dies kann zu verheerenden Explosionen führen, die grosse Zerstörungen anrichten und schwere Verletzungen oder Todesfälle verursachen können. Massenexplosionen (z. B. bei den als Gruppe A klassifizierten Stoffen) können ganze Bereiche verwüsten.
- Erdrückungsgefahr: Bei einer Explosion können Trümmer, Splitter und andere Materialien mit hoher Geschwindigkeit projiziert werden, was zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann.
- Druckwellen: Die Explosion kann Druckwellen erzeugen, die sowohl Menschen als auch Objekte schädigen können, indem sie Türen aufreissen, Fenster zerbrechen oder Verletzungen durch die ersten Auswirkungen des Drucks hervorrufen.
- Brandgefahr: Viele explosive Stoffe sind auch entzündbar oder können Brände auslösen, die sich schnell ausbreiten können und zusätzliche Gefahr für Menschen und die Umgebung darstellen.
- Chemische Reaktionen: Einige explosive Stoffe können in Verbindung mit anderen Chemikalien oder Materialien gefährliche chemische Reaktionen eingehen, was zu weiteren Risiken führen kann.
- Umweltgefahren: Bei Explosionen oder Bränden können giftige oder gefährliche Stoffe freigesetzt werden, die die Umwelt schädigen und biologische Systeme gefährden können.
Sicherheitsrisiken während des Transports und der Handhabung:
Der Transport und die Lagerung von Gefahrgut der Klasse 1 erfordern besondere Sicherheitsvorkehrungen und Fachkenntnisse. Unsachgemässer Umgang, unzureichende Schulungen oder fehlerhafte Verpackung können die Risiken erheblich erhöhen.
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 1 zu minimieren, ist es unerlässlich, strenge Sicherheitsvorschriften einzuhalten, geeignete Lager- und Transportmethoden zu verwenden und sicherzustellen, dass alle beteiligten Personen entsprechend geschult sind. - Explosive Stoffe: Dazu zählen feste oder flüssige Stoffe (oder Stoffgemische), die durch chemische Reaktionen Gase erzeugen können, die solche Temperaturen, Drücke und Geschwindigkeiten erreichen, dass dadurch Zerstörungen in der Umgebung entstehen können.
-
Klasse 2 – Gase
Der Begriff der Klasse 2 umfasst reine Gase, Gasgemische, Gemische eines oder mehrerer Gase mit einem oder mehreren anderen Stoffen sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.
Gase sind Stoffe, die
- bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 300 kPa (3 bar) haben oder
- bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa vollständig gasförmig sind.
- Anmerkung:
- UN 1052 FLUORWASsERSTOFF, WASsERFREI ist dennoch ein Stoff der Klasse 8.
- Ein reines Gas darf andere Bestandteile enthalten, die vom Produktionsprozess herrühren oder die hinzugefügt werden, um die Stabilität des Produkts aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, die Konzentration dieser Bestandteile verändert nicht die Klassifizierung oder die Beförderungsvorschriften wie Füllfaktor, Fülldruck oder Prüfdruck.
- Die n.a.g.-Eintragungen in Unterabschnitt 2.2.2.3 können sowohl reine Gase als auch Gemische einschliessen.
- Anmerkung:
Gaszustände und Gegenstände
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 2 sind wie folgt unterteilt:
- Verdichtetes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung unter Druck verpackten Zustand bei –50 °C vollständig gasförmig ist; diese Kategorie schliesst alle Gase ein, die eine kritische Temperatur von höchstens –50 °C haben.
- Verflüssigtes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung unter Druck verpackten Zustand bei Temperaturen über –50 °C teilweise flüssig ist. Es wird unterschieden zwischen:
- unter hohem Druck verflüssigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur über –50 °C bis höchstens +65 °C hat; und
- unter geringem Druck verflüssigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur über +65 °C hat.
- Tiefgekühlt verflüssigtes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung verpackten Zustand wegen seiner niedrigen Temperatur teilweise flüssig ist.
- Gelöstes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung unter Druck verpackten Zustand in einem Lösungsmittel in flüssiger Phase gelöst ist.
- Druckgaspackungen und Gefässe, klein, mit Gas (Gaspatronen).
- Andere Gegenstände, die Gas unter Druck enthalten.
- Nicht unter Druck stehende Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben).
- Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe.
- Adsorbiertes Gas: Ein Gas, das im für die Beförderung verpackten Zustand an einem festen porösen Werkstoff adsorbiert ist, was zu einem Gefässinnendruck bei 20 °C von weniger als 101,3 kPa und bei 50 °C von weniger als 300 kPa führt.
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe und Gegenstände (ausgenommen Druckgaspackungen und Chemikalien unter Druck) der Klasse 2 werden ihren gefährlichen Eigenschaften entsprechend einer der folgenden Gruppen zugeordnet:
- A erstickend
- O oxidierend
- F entzündbar
- T giftig
- TF giftig, entzündbar
- TC giftig, ätzend
- TO giftig, oxidierend
- TFC giftig, entzündbar, ätzend
- TOC giftig, oxidierend, ätzend
Wenn nach diesen Kriterien Gase oder Gasgemische gefährliche Eigenschaften haben, die mehr als einer Gruppe zugeordnet werden können, haben die mit dem Buchstaben T bezeichneten Gruppen Vorrang vor allen anderen Gruppen. Die mit dem Buchstaben F bezeichneten Gruppen haben Vorrang vor den mit dem Buchstaben A oder O bezeichneten Gruppen.
- Anmerkung:
- In den UN-Modellvorschriften, im IMDG-Code und in den Technischen Anweisungen der ICAO werden die Gase auf Grund ihrer Hauptgefahr einer der folgenden drei Unterklassen zugeordnet:
- Unterklasse 2.1: entzündbare Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben F bezeichnet sind)
- Unterklasse 2.2: nicht entzündbare, nicht giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben A oder O bezeichnet sind)
- Unterklasse 2.3: giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben T bezeichnet sind, d. h. T, TF, TC, TO, TFC und TOC).
- Gefässe, klein, mit Gas (UN-Nummer 2037), sind entsprechend der vom Inhalt ausgehenden Gefahren den Gruppen A bis TOC zuzuordnen.
- Ätzende Gase gelten als giftig und werden daher der Gruppe TC, TFC oder TOC zugeordnet.
- In den UN-Modellvorschriften, im IMDG-Code und in den Technischen Anweisungen der ICAO werden die Gase auf Grund ihrer Hauptgefahr einer der folgenden drei Unterklassen zugeordnet:
Gefahren, die aus der Klasse 2 resultieren:
Gefahrgut der Klasse 2 umfasst Gase, die in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, darunter entzündbare Gase, giftige Gase und nicht entzündbare, nicht giftige Gase. Die Gefahren, die von Gefahrgut der Klasse 2 ausgehen, sind vielfältig und können sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen. Hier sind die wichtigsten Gefahren:
- Entzündliche Gase:
- Brandgefahr: Entzündbare Gase können bei Kontakt mit einer Zündquelle (z. B. Funken, offene Flamme) leicht entzündet werden und explosive Brände verursachen.
- Explosionen: In geschlossenen Räumen oder Bereichen mit schlechter Belüftung können sich explosive Gemische mit Luft bilden, die bei einer Zündquelle zu heftigen Explosionen führen können.
- Toxische Gase:
- Gesundheitsrisiken: Toxische Gase können bei Einatmen gesundheitliche Schäden verursachen, die von Reizungen der Atemwege bis hin zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod reichen können.
- Umweltschäden: Freisetzung toxischer Gase kann die Umwelt schädigen, insbesondere wenn sie in die Luft oder in das Wasser gelangen.
- Druckgefahren:
- Hochdruckbehälter: Gase werden häufig unter Druck gespeichert. Bei Beschädigung oder unsachgemässer Handhabung können solche Behälter explodieren oder zerbersten, was zu sofortiger Gefahr durch die freigesetzten Gase führt.
- Gefahr der Erstickung:
- Sauerstoffverdrängung: Einige nicht giftige Gase können den Sauerstoff in der Umgebung verdrängen, was zu Erstickungsgefahr führen kann, insbesondere in geschlossenen Räumen.
- Kältegefahr:
- Kryogene Gase: Einige Gase werden bei extrem niedrigen Temperaturen gespeichert. Der Kontakt mit diesen kann zu Erfrierungen und anderen kältebedingten Verletzungen führen.
- Einfluss auf die Umwelt:
- Freisetzung: Die Freisetzung von Gasen in die Umwelt kann auch Auswirkungen auf die Luftqualität haben und die Umgebung schädigen.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Risiken, die von Gefahrgut der Klasse 2 ausgehen, zu minimieren, ist es wichtig, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, darunter:
- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen arbeiten, sollten gründlich geschult sein.
- Einhaltung von Vorschriften: Die jeweiligen nationalen und internationalen Vorschriften für den Transport, die Lagerung und die Behandlung von Gefahrgut der Klasse 2 sollten strikt befolgt werden.
- Sichere Lagerung: Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Leckagen oder Explosionen sind zu implementieren.
- Einsatz von Schutzausrüstung: Bei der Handhabung toxischer oder entzündbarer Gase sollte geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.
Insgesamt sind die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 2 erheblich und erfordern sorgfältige Beachtung und Management, um die Sicherheit von Menschen und Umwelt zu gewährleisten.
-
Klasse 3 – Entzündbare flüssige Stoffe
Der Begriff der Klasse 3 umfasst Stoffe sowie Gegenstände, die Stoffe dieser Klasse enthalten, die
- gemäss Absatz a) der Begriffsbestimmung für „flüssig“ in Abschnitt 1.2.1 flüssige Stoffe sind;
- einen Dampfdruck bei 50 °C von höchstens 300 kPa (3 bar) haben und bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa nicht vollständig gasförmig sind und
- einen Flammpunkt von höchstens 60 °C haben (wegen der entsprechenden Prüfung siehe Unterabschnitt 2.3.3.1).
- Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch flüssige Stoffe und feste Stoffe in geschmolzenem Zustand mit einem Flammpunkt über 60 °C, die auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden. Diese Stoffe sind der UN-Nummer 3256 zugeordnet.
- Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch desensibilisierte explosive flüssige Stoffe. Desensibilisierte explosive flüssige Stoffe sind explosive Stoffe, die in Wasser oder anderen Flüssigkeiten gelöst oder suspendiert sind, um zur Unterdrückung ihrer explosiven Eigenschaften ein homogenes flüssiges Gemisch zu bilden. In Kapitel 3.2 Tabelle A sind dies die Eintragungen der UN-Nummern 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379 und 3555.
- Anmerkung:
- Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 35 °C, die gemäss den Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 32.2.5 keine selbstständige Verbrennung unterhalten, sind keine Stoffe der Klasse 3; werden diese Stoffe jedoch auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben und befördert, sind sie Stoffe dieser Klasse.
- In Abweichung zu Absatz 2.2.3.1.1 gilt Dieselkraftstoff oder Gasöl oder Heizöl (leicht), einschliesslich synthetisch hergestellter Produkte, mit einem Flammpunkt über 60 °C bis höchstens 100 °C als Stoff der Klasse 3 UN-Nummer 1202.
- Entzündbare flüssige Stoffe, die nach den Absätzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen sehr giftig sind, und giftige Stoffe mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber sind Stoffe der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1). Flüssige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig sind, sind in ihrer offiziellen Benennung für die Beförderung in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2) als „beim Einatmen giftig“ bezeichnet oder in Spalte (6) durch die Sondervorschrift 354 gekennzeichnet.
- Als Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide) verwendete flüssige Stoffe und Präparate, die sehr giftig, giftig oder schwach giftig sind und einen Flammpunkt von 23 °C oder darüber haben, sind Stoffe der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1).
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 3 sind wie folgt unterteilt:
- F Entzündbare flüssige Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
F1 Entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C
F2 Entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt über 60 °C, die auf oder über ihren Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden (erwärmte Stoffe)
- F3 Gegenstände, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten
- FT Entzündbare flüssige Stoffe, giftig
FT1 Entzündbare flüssige Stoffe, giftig
FT2 Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide)
- FC Entzündbare flüssige Stoffe, ätzend
- FTC Entzündbare flüssige Stoffe, giftig, ätzend
- D Desensibilisierte explosive flüssige Stoffe
Gefahrgut der Klasse 3 umfasst entzündbare Flüssigkeiten, die aufgrund ihrer Eigenschaften ernsthafte Risiken für Menschen, die Umwelt und Sachwerte darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Gefahrgut der Klasse 3 ausgehen:
- Brandgefahr:
- Entzündbarkeit: Entzündbare Flüssigkeiten können leicht entzündet werden, entweder durch Zündquellen wie offene Flammen, Funken oder hohe Temperaturen.
- Flammenausbreitung: Bei der Entzündung kann sich das Feuer schnell ausbreiten, besonders wenn die Flüssigkeit in der Nähe von brennbaren Materialien gelagert wird.
- Explosion:
- Dämpfe: Viele entzündbare Flüssigkeiten erzeugen brennbare Dämpfe, die sich mit Luft vermischen und explosive Gemische bilden können. Dies kann in geschlossenen Räumen oder schlecht belüfteten Bereichen besonders gefährlich sein.
- Vapor Pressure: Bei hohen Temperaturen können diese Flüssigkeiten einen hohen Dampfdruck erzeugen, was das Risiko einer Explosion erhöht.
- Gesundheitsrisiken:
- Toxizität: Einige entzündbare Flüssigkeiten können giftig oder gesundheitsschädlich sein, wenn sie eingeatmet, verschluckt oder über die Haut aufgenommen werden. Dies kann zu Reizungen atemweg, Haut oder Augen führen.
- Langzeitfolgen: Bestimmte chemische Dämpfe können langfristige gesundheitliche Auswirkungen haben, einschliesslich Schädigung des Nervensystems oder anderer Organe.
- Umweltschäden:
- Verschmutzung: Bei Leckagen oder Unfällen können entzündbare Flüssigkeiten in die Umwelt gelangen und Wasserquellen, Böden und Ökosysteme schädigen.
- Schadstoffe: Durch die Verbrennung dieser Flüssigkeiten können gefährliche Schadstoffe freigesetzt werden, die die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken mit sich bringen.
- Reaktionen mit anderen Materialien:
- Chemische Reaktionen: Entzündbare Flüssigkeiten können mit anderen Chemikalien reagieren, was unvorhersehbare Gefahren und zusätzliche Risiken birgt.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren, die von Gefahrgut der Klasse 3 ausgehen, zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit entzündbaren Flüssigkeiten umgehen, sollten gründlich geschult sein, umrisiken zu verstehen und geeignete Verfahren einzuhalten.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Flüssigkeiten sollten beachtet werden.
- Geeignete Lagerung: Entzündbare Flüssigkeiten sollten in speziellen Behältern aufbewahrt werden, die für ihre Eigenschaften geeignet sind, und von Zündquellen ferngehalten werden.
- Belüftung: Arbeitsbereiche, in denen entzündbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden, sollten gut belüftet sein, um die Ansammlung von schädlichen Dämpfen zu vermeiden.
- Einsatz von Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Handschuhe und Atemschutz sollten verwendet werden, um den Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.
Insgesamt erfordern die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 3 besondere Aufmerksamkeit und ein sorgfältiges Management, um die Sicherheit von Personen und die Umwelt zu gewährleisten.
-
Klasse 4.1 – Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe
Der Begriff der Klasse 4.1 umfasst entzündbare Stoffe und Gegenstände, desensibilisierte explosive Stoffe, die gemäss Absatz a) der Begriffsbestimmung für „fest“ in Abschnitt 1.2.1 feste Stoffe sind, selbstzersetzliche flüssige oder feste Stoffe und polymerisierende Stoffe.
Der Klasse 4.1 sind zugeordnet:
- leicht brennbare feste Stoffe und Gegenstände
- selbstzersetzliche feste oder flüssige Stoffe
- desensibilisierte explosive feste Stoffe
- mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe
- polymerisierende Stoffe
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.1 sind wie folgt unterteilt:
- F Entzündbare feste Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- F1 organische Stoffe
- F2 organische Stoffe, geschmolzen
- F3 anorganische Stoffe
- F4 Gegenstände
- FO Entzündbare feste Stoffe, entzündend (oxidierend) wirkend
- FT Entzündbare feste Stoffe, giftig
- FT1 organische Stoffe, giftig
- FT2 anorganische Stoffe, giftig
- FC Entzündbare feste Stoffe, ätzend
- FC1 organische Stoffe, ätzend
- FC2 anorganische Stoffe, ätzend
- D Desensibilisierte explosive feste Stoffe ohne Nebengefahr
- DT Desensibilisierte explosive feste Stoffe, giftig
- SR Selbstzersetzliche Stoffe
- SR1 Stoffe, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist
- SR2 Stoffe, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist
- PM Polymerisierende Stoffe
- PM1 Stoffe, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist
- PM2 Stoffe, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist.
Entzündbare feste Stoffe
- Entzündbare feste Stoffe sind leicht brennbare feste Stoffe und feste Stoffe, die durch Reibung in Brand geraten können.
- Leicht brennbare feste Stoffe sind pulverförmige, körnige oder pastöse Stoffe, die gefährlich sind, wenn sie durch einen kurzen Kontakt mit einer Zündquelle wie einem brennenden Zündholz leicht entzündet werden können und sich die Flammen schnell ausbreiten. Die Gefahr kann dabei nicht nur vom Feuer, sondern auch von giftigen Verbrennungsprodukten ausgehen. Metallpulver sind wegen der Schwierigkeit beim Löschen eines Feuers besonders gefährlich, da normale Löschmittel wie Kohlendioxid oder Wasser die Gefahr vergrössern können.
- Metallpulver sind Pulver von Metallen oder Metalllegierungen.
Selbstzersetzliche Stoffe
Für Zwecke des ADR sind selbstzersetzliche Stoffe thermisch instabile Stoffe, die sich auch ohne Beteiligung von Sauerstoff (Luft) stark exotherm zersetzen können. Stoffe gelten nicht als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1, wenn:
- sie explosive Stoffe gemäss den Kriterien der Klasse 1 sind;
- sie entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe gemäss dem Klassifizierungsverfahren der Klasse 5.1 sind, ausgenommen Gemische entzündend (oxidierend) wirkender Stoffe, die mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und die dem in Bem. 2 festgelegten Klassifizierungsverfahren zu unterziehen sind
- sie organische Peroxide gemäss den Kriterien der Klasse 5.2 sind
- ihre Zersetzungswärme geringer als 300 J/g ist oder
- ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) bei einem Versandstück von 50 kg höher als 75 °C ist.
Anmerkungen:
- Die Zersetzungswärme kann durch eine beliebige international anerkannte Methode bestimmt werden, z. B. der dynamischen Differenz-Kalorimetrie und der adiabatischen Kalorimetrie.
Gemische entzündend (oxidierend) wirkender Stoffe, die den Kriterien der Klasse 5.1 entsprechen, mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und nicht den in Absatz a), c), d) oder e) aufgeführten Kriterien entsprechen, sind dem Klassifizierungsverfahren für selbstzersetzliche Stoffe zu unterziehen. - Gemische, welche die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe der Typen B bis F aufweisen, sind als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 zu klassifizieren.
Gemische, welche nach dem Grundsatz des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil II Abschnitt 20.4.3 g) die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe des Typs G aufweisen, gelten für Zwecke der Klassifizierung als Stoffe der Klasse 5.1. - Die Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) ist die niedrigste Temperatur, bei der sich ein Stoff in versandmässiger Verpackung exotherm zersetzen kann.
- Stoffe, welche die Eigenschaften von selbstzersetzlichen Stoffen aufweisen, sind als solche zuzuordnen, auch wenn diese Stoffe ein positives Prüfergebnis für die Zuordnung zur Klasse 4.2 aufweisen.
Desensibilisierte explosive feste Stoffe
Desensibilisierte explosive feste Stoffe sind Stoffe, die mit Wasser oder mit Alkoholen angefeuchtet oder mit anderen Stoffen verdünnt sind, um ihre explosiven Eigenschaften zu unterdrücken. Dies sind die UN-Nummern 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 und 3474.
Mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe
Stoffe, die
- gemäss den Prüfreihen 1 und 2 vorläufig der Klasse 1 zugeordnet wurden, jedoch durch die Prüfreihe 6 von der Klasse 1 freigestellt sind,
- keine selbstzersetzlichen Stoffe der Klasse 4.1 sind,
- keine Stoffe der Klasse 5.1 oder 5.2 sind,
werden ebenfalls der Klasse 4.1 zugeordnet. Die UN-Nummern 2956, 3241, 3242 und 3251 sind solche Eintragungen.
Polymerisierende Stoffe
Polymerisierende Stoffe sind Stoffe, die ohne Stabilisierung eine stark exotherme Reaktion eingehen können, die unter normalen Beförderungsbedingungen zur Bildung grösserer Moleküle oder zur Bildung von Polymeren führt. Solche Stoffe gelten als polymerisierende Stoffe der Klasse 4.1, wenn:
- ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) unter den Bedingungen (mit oder ohne chemische Stabilisierung bei der Übergabe zur Beförderung) und in den Verpackungen, Grosspackmitteln (IBC) oder Tanks, in denen der Stoff oder das Gemisch befördert wird, höchstens 75 °C beträgt;
- sie eine Reaktionswärme von mehr als 300 J/g aufweisen und
- sie keine anderen Kriterien für eine Zuordnung zu den Klassen 1 bis 8 erfüllen.
Ein Gemisch, das die Kriterien eines polymerisierenden Stoffes erfüllt, ist als polymerisierender Stoff der Klasse 4.1 zuzuordnen
Gefahrgut der Klasse 4.1 umfasst entzündbare feste Stoffe und ist durch verschiedene Gefahren gekennzeichnet, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 4.1 ausgehen:
- Brandgefahr:
- Entzündbarkeit: Entzündbare feste Stoffe können leicht entzündet werden, entweder durch direkte Zündquellen wie offene Flammen, Funken oder hohe Temperaturen.
- Selbstentzündung: Einige Stoffe in dieser Klasse können sich selbst entzünden, wenn sie Temperaturen erreichen, die ihre Zündtemperatur überschreiten.
- Explosive Reaktionen:
- Reaktivität: Bestimmte feste Stoffe können mit anderen Materialien oder Chemikalien reagieren und dabei explosive oder gefährliche Reaktionen hervorrufen.
- Drop Tests: Einige feste, entzündbare Stoffe können beim Stoss oder durch mechanischen Druck explodieren.
- Rauch und Dämpfe:
- Toxische Dämpfe: Bei der Verbrennung oder Zersetzung können viele dieser Stoffe toxische oder gesundheitsschädliche Dämpfe und Gase freisetzen, die gesundheitsschädlich sein können.
- Rauchentwicklung: Bei einem Brand kann giftiger Rauch entstehen, der die Gefahr für Menschen erhöht, die sich in der Nähe aufhalten.
- Umweltschäden:
- Verschmutzung: Die Freisetzung von festen, entzündbaren Stoffen in die Umwelt kann Böden und Wasserquellen schädigen und die dortige Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigen.
- Nachhaltige Auswirkungen: Chemikalien, die bei einem Brand oder Unfall freigesetzt werden, können langfristige Umweltauswirkungen haben.
- Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:
- Transportgefahren: Entzündbare feste Stoffe müssen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen transportiert werden, um Risiken bei Unfällen, Leckagen oder Komplikationen zu minimieren.
- Unzureichende Lagerung: Unsachgemässe Lagerung kann zu unbeabsichtigten Bränden führen. Es ist wichtig, dass solche Stoffe an einem sicheren, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 4.1 zu minimieren, sollten die folgenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen arbeiten, sollten in den Risiken und dem sicheren Umgang geschult sein.
- Einhaltung von Vorschriften: Die jeweiligen nationalen und internationalen Vorschriften zur Handhabung, Lagerung und Transport müssen streng beachtet werden.
- Geeignete Lagerbedingungen: Entzündbare feste Stoffe sollten in dafür geeigneten Behältern und an einem sicheren Ort gelagert werden, fern von potenziellen Zündquellen.
- Brandverhütung: Massnahmen zur Brandverhütung, wie Brandmeldeanlagen und Feuerlöschgeräte, sollten in der Nähe vorhanden sein.
- Schutzausrüstung: Ein geeigneter Gesundheitsschutz und persönliche Schutzausrüstung sollten verwendet werden, um den Kontakt mit den Stoffen zu minimieren.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 4.1 besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt, um die Sicherheit von Menschen und die Umwelt zu gewährleisten.
-
Klasse 4.2 – Selbstentzündliche Stoffe
Der Begriff der Klasse 4.2 umfasst:
- pyrophore Stoffe; dies sind Stoffe einschließlich Gemische und Lösungen (flüssig oder fest), die sich in Berührung mit Luft schon in kleinen Mengen innerhalb von fünf Minuten entzünden. Diese Stoffe sind die am leichtesten selbstentzündlichen Stoffe der Klasse 4.2; und
- selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gegenstände; dies sind Stoffe und Gegenstände einschließlich Gemische und Lösungen, die in Berührung mit Luft ohne Energiezufuhr selbsterhitzungsfähig sind. Diese Stoffe können sich nur in großen Mengen (mehrere Kilogramm) und nach einem längeren Zeitraum (Stunden oder Tagen) entzünden.
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.2 sind wie folgt unterteilt:
- S Selbstentzündliche Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- S1 organische flüssige Stoffe
- S2 organische feste Stoffe
- S3 anorganische flüssige Stoffe
- S4 anorganische feste Stoffe
- S5 metallorganische Stoffe
- S6 Gegenstände
- SW Selbstentzündliche Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- SW1 Stoffe
- SW2 Gegenstände
- SO Selbstentzündliche oxidierende Stoffe
- ST Selbstentzündliche giftige Stoffe
- ST1 organische giftige flüssige Stoffe
- ST2 organische giftige feste Stoffe
- ST3 anorganische giftige flüssige Stoffe
- ST4 anorganische giftige feste Stoffe
- SC Selbstentzündliche ätzende Stoffe
- SC1 organische ätzende flüssige Stoffe
- SC2 organische ätzende feste Stoffe
- SC3 anorganische ätzende flüssige Stoffe
- SC4 anorganische ätzende feste Stoffe.
Die Selbsterhitzung eines Stoffes ist ein Prozess, bei dem die fortschreitende Reaktion dieses Stoffes mit Sauerstoff (der Luft) Wärme erzeugt. Wenn die Menge der entstandenen Wärme grösser ist als die Menge der abgeführten Wärme, führt dies zu einem Anstieg der Temperatur des Stoffes, was nach einer Induktionszeit zur Selbstentzündung und Verbrennung führen kann.
Wenn nicht namentlich genannte Stoffe oder Gegenstände auf Grund der Prüfverfahren der Eintragungen 4.2 zugeordnet werden, gelten folgende Kriterien:
- selbstentzündliche (pyrophore) feste Stoffe sind der Klasse 4.2 zuzuordnen, wenn sie sich beim Fall aus 1 m Höhe oder innerhalb von fünf Minuten danach entzünden;
- selbstentzündliche (pyrophore) flüssige Stoffe sind der Klasse 4.2 zuzuordnen,
- Stoffe, bei denen in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenlänge bei 140 °C Versuchstemperatur innerhalb von 24 Stunden eine Selbstentzündung oder ein Temperaturanstieg auf über 200 °C eintritt, sind der Klasse 4.2 zuzuordnen. Dieses Kriterium basiert auf der Selbstentzündungstemperatur von Holzkohle, die 50 °C für eine kubische Probe von 27 m3 beträgt. Stoffe mit einer Selbstentzündungstemperatur von mehr als 50 °C für ein Volumen von 27 m3 sind nicht der Klasse 4.2 zuzuordnen.
- wenn sie, aufgetragen auf ein inertes Trägermaterial, sich innerhalb von fünf Minuten entzünden oder
- wenn sie bei negativem Ergebnis der Prüfung aufgetragen auf ein eingerissenes trockenes Filterpapier (Whatman-Filter Nr. 3), dieses innerhalb von fünf Minuten entzünden oder verkohlen;
Anmerkung:
- Stoffe, die in Verpackungen mit einem Volumen von höchstens 3 m3 befördert werden, unterliegen nicht der Klasse 4.2, wenn bei Prüfung in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenlänge bei 120 °C innerhalb von 24 Stunden keine Selbstentzündung oder ein Temperaturanstieg auf über 180 °C eintritt.
- Stoffe, die in Verpackungen mit einem Volumen von höchstens 450 Liter befördert werden, unterliegen nicht der Klasse 4.2, wenn bei Prüfung in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenlänge bei 100 °C innerhalb von 24 Stunden keine Selbstentzündung oder ein Temperaturanstieg auf über 160 °C eintritt.
- Da metallorganische Stoffe in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften der Klasse 4.2 oder 4.3 mit zusätzlichen Nebengefahren zugeordnet werden können, ist in Abschnitt 2.3.5 ein besonderes Flussdiagramm für die Klassifizierung dieser Stoffe aufgeführt.
Gefahrgut der Klasse 4.2 umfasst die sogenannten "selbstentzündlichen Stoffe" oder "selbstentzündlichen, besonders reaktiven Stoffe". Diese Stoffe sind aufgrund ihrer Eigenschaften mit erheblichen Gefahren verbunden, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 4.2 ausgehen:
- Selbstentzündung:
Selbstentzündliche Eigenschaften: Stoffe der Klasse 4.2 haben die Fähigkeit, sich bei normalen Temperaturen ohne externe Zündquelle selbst zu entzünden. Dies kann zu plötzlichen Bränden führen, die schwierig zu kontrollieren sein können. - Reaktivität:
Chemische Reaktionen: Diese Stoffe können leicht mit anderen Chemikalien oder Materialien reagieren, was zu gefährlichen und oft autonomen chemischen Reaktionen führen kann. Solche Reaktionen können explosionsartige Effekte hervorrufen. - Brandgefahr:
Schnelle Flammenausbreitung: Da die Stoffe selbstentzündlich sind, kann ein Feuer in der Umgebung schnell auf den Stoff übergreifen, was die Gefahr eines grossflächigen Brandes erhöht. - Toxische Dämpfe:
Freisetzung gefährlicher Gase: Bei der Zersetzung oder Verbrennung dieser Stoffe können gefährliche, giftige oder gesundheitsschädliche Dämpfe und Gase freigesetzt werden, die ernsthafte Gesundheitsrisiken darstellen können. - Umweltschäden:
Umweltverschmutzung: Die Freisetzung selbstentzündlicher Stoffe in die Umwelt kann zur Schädigung von Böden, Wasserquellen und Ökosystemen führen. Diese Stoffe können auch langfristige negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. - Sicherheitsrisiken im Transport und bei der Lagerung:
- Transportgefahren: Selbstentzündliche Stoffe müssen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen transportiert werden, um Risiken bei Unfällen, Leckagen oder Komplikationen zu minimieren.
- Unzureichende Lagerung: Unsachgemässe Lagerung kann die Gefahr der Selbstentzündung erhöhen. Diese Stoffe sollten an kühlen, gut belüfteten Orten ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 4.2 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen arbeiten, müssen umfassend geschult werden, um die Risiken zu verstehen und geeignete Verfahren zu verwenden.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe sollten strikt eingehalten werden.
- Geeignete Lagerbedingungen: Selbstentzündliche Stoffe sollten in speziellen Behältern aufbewahrt werden, die für ihre Eigenschaften geeignet sind, und von potenziellen Zündquellen und anderen gefährlichen Materialien ferngehalten werden.
- Brandverhütung: Massnahmen zur Brandverhütung sollten vorhanden sein, einschliesslich Feuerlöschanlagen und Sicherheitsausrüstungen.
- Einsatz von Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Atemschutz und andere persönliche Schutzausrüstungen sollten verwendet werden, um den direkten Kontakt mit den stofflichen Gefahren zu minimieren.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 4.2 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Menschen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten
-
Klasse 4.3 – Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
Der Begriff der Klasse 4.3
umfasst Stoffe, die bei Reaktion mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, welche mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können, sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 4.3 sind wie folgt unterteilt:
- W Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
W1 flüssige Stoffe
W2 feste Stoffe
W3 Gegenstände
- WF1 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, flüssig
- WF2 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, fest
- WS Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, selbsterhitzungsfähig, fest
- WO Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündend (oxidierend) wirkend, fest
- WT Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, giftig
WT1 flüssige Stoffe
WT2 feste Stoffe
WC Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ätzend
WC1 flüssige Stoffe
WC2 feste Stoffe
WFC Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, ätzend.
Eigenschaften
Bestimmte Stoffe können in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, welche mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Solche Gemische werden durch alle gewöhnlichen Zündquellen, z. B. offenes Feuer, von einem Werkzeug ausgehende Funken oder ungeschützte Leuchtmittel, leicht entzündet. Die dabei entstehenden Druckwellen und Flammen können Menschen und die Umwelt gefährden. Ein Prüfverfahren, wird angewendet, um festzustellen, ob die Reaktion eines Stoffes mit Wasser zur Entwicklung einer gefährlichen Menge von möglicherweise entzündbaren Gasen führt. Dieses Prüfverfahren darf nicht bei pyrophoren Stoffen angewendet werden.
Gefahrgut der Klasse 4.3 umfasst „nasshafte Stoffe“, die Wasser unter bestimmten Bedingungen gefährlich reagieren. Diese Materialien können bei Kontakt mit Wasser gefährliche Reaktionen hervorrufen, die sowohl für Menschen als auch für die Umwelt ernsthafte Risiken darstellen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 4.3 ausgehen:
- Reaktivität mit Wasser:
Exotherme Reaktionen: Stoffe der Klasse 4.3 können mit Wasser reagieren und dabei Wärme erzeugen, was zu einer Temperatursteigerung und möglicherweise zu einer Explosion oder zu einem Brand führen kann. Diese Reaktion kann heftig sein und gefährliche Dämpfe oder Gase erzeugen. - Brandgefahr:
Entstehung brennbarer Gase: Die Reaktion mit Wasser kann dazu führen, dass brennbare Gase freigesetzt werden, die leicht entzündlich sind und mit der Luft explosive Gemische bilden können. Dies erhöht das Risiko von Bränden und Explosionen. - Toxische Dämpfe:
Gesundheitsrisiken: Bei der Reaktion mit Wasser können giftige oder gesundheitsschädliche Dämpfe und Gase freigesetzt werden, die beim Einatmen ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen können, einschliesslich Atemwegsreizungen oder schwerwiegenderen Gesundheitsfolgen. - Umweltschäden:
Verschmutzung: Die Freisetzung dieser Stoffe oder ihrer Reaktionsprodukte in die Umwelt kann zu erheblichen Schäden an Wasserquellen, Böden und Ökosystemen führen. Der Kontakt mit Wasser kann dazu führen, dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen. - Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:
Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung von Stoffen der Klasse 4.3 müssen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um Risiken bei Unfällen, Leckagen oder anderen Komplikationen zu minimieren. Unsachgemässe Lagerung oder Umgang kann die Gefahr eines Vorfalls erheblich erhöhen.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 4.3 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen umgehen, sollten entsprechend geschult sein, um die Risiken zu verstehen und sichere Verfahren anzuwenden.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt eingehalten werden.
- Geeignete Lagerbedingungen: Stoffe der Klasse 4.3 sollten in speziellen Behältern aufbewahrt und von Wasserquellen ferngehalten werden, um gefährliche Reaktionen zu vermeiden.
- Sicherheitsmassnahmen: Es sollten Massnahmen zur Brandverhütung sowie geeignete Feuerlöschmittel in der Nähe vorhanden sein.
- Einsatz von Schutzausrüstung: Schutzkleidung, Atemschutz und andere persönliche Schutzausrüstungen sollten verwendet werden, um den direkten Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 4.3 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Menschen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.
- W Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
-
Klasse 5.1 – Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Der Begriff der Klasse 5.1
umfasst Stoffe, die obwohl selbst nicht notwendigerweise brennbar, im Allgemeinen durch Abgabe von Sauerstoff einen Brand verursachen oder einen Brand anderer Stoffe unterstützen können, sowie Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe der Klasse 5.1 sowie die Gegenstände, die solche Stoffe enthalten, sind wie folgt unterteilt:
- O Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe ohne Nebengefahr oder Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
O1 flüssige Stoffe
O2 feste Stoffe
O3 Gegenstände
OF Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, entzündbar
OS Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, selbsterhitzungsfähig
OW Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
OT Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, giftig
OT1 flüssige Stoffe
OT2 feste Stoffe
OC Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, ätzend
OC1 flüssige Stoffe
OC2 feste Stoffe
OTC Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, giftig, ätzend
Gefahrgut der Klasse 5.1 umfasst „oxidierende Stoffe“. Diese Stoffe besitzen die Fähigkeit, durch chemische Reaktionen mit brennbaren Materialien und anderen Stoffen die Verbrennung zu fördern oder zu intensivieren. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 5.1 ausgehen:
- Brandgefahr:
- Förderung von Bränden: Oxidierende Stoffe können Brände auslösen oder bestehende Brände erheblich verstärken, indem sie den Sauerstoffgehalt erhöhen. Dies geschieht unabhängig von der Zündquelle.
- Reaktion mit brennbaren Materialien:
Wenn oxidierende Stoffe in Kontakt mit brennbaren Materialien oder anderen chemischen Substanzen kommen, können sie eine schnelle und intensive Verbrennung verursachen.
- Explosionsgefahr:
- Exotherme Reaktionen: Bei bestimmten Bedingungen können oxidierende Stoffe explosive Reaktionen hervorrufen, insbesondere wenn sie mit brennbaren Stoffen kombiniert werden.
- Unvorhersehbare Reaktivität: Die Reaktivität von oxidierenden Stoffen kann variieren, was sie schwer vorhersehbar macht, insbesondere wenn sie mit anderen Chemikalien in Berührung kommen.
- Gesundheitsrisiken:
- Toxische Dämpfe: Einige oxidierende Stoffe können giftige oder gesundheitsschädliche Dämpfe oder Gase freisetzen, die beim Einatmen gesundheitliche Probleme verursachen können.
- Reizungen: Der Kontakt mit oxidierenden Stoffen kann Haut- und Atemwegsreizungen hervorrufen.
- Umweltschäden:
Verschmutzung: Bei einem Unfall oder einer Leckage können oxidierende Stoffe in die Umwelt gelangen und dort schädliche Auswirkungen haben, sowohl auf den Boden als auch auf Wasserquellen und Ökosysteme. - Sicherheitsrisiken im Transport und bei der Lagerung:
- Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung oxidierender Stoffe müssen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um die Risiken bei Unfällen oder Komplikationen zu minimieren.
- Besondere Lagerbedingungen: Diese Stoffe sollten von brennbaren Materialien und Zündquellen ferngehalten werden, um das Risiko einer Brand- oder Explosionsgefahr zu minimieren.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 5.1 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit oxidierenden Stoffen umgehen, sollten entsprechend geschult sein, um die Risiken zu verstehen und sichere Verfahren anzuwenden.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt eingehalten werden.
- Geeignete Lagerung: Oxidierende Stoffe sollten in speziellen Behältern gelagert werden, die gegen Brände schützen und von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Brandverhütung: Notwendige Massnahmen zur Brandverhütung, wie Feuerlöschgeräte und Brandmeldesysteme, sollten vorhanden sein.
- Einsatz von Schutzausrüstung: Geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Atemschutz, sollte verwendet werden, um den direkten Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 5.1 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Personen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.
- O Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe ohne Nebengefahr oder Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
-
Klasse 5.2 – Organische Peroxide
Der Begriff der Klasse 5.2
umfasst organische Peroxide und Zubereitungen organischer Peroxide. diese werden nach Temperaturempfindlichkeit unterteilt Die Stoffe der Klasse 5.2 sind wie folgt unterteilt:
- P1 organische Peroxide, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist
- P2 organische Peroxide, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist.
Organische Peroxide sind organische Stoffe, die das bivalente -O-O-Strukturelement enthalten und die als Derivate des Wasserstoffperoxids, in welchem ein Wasserstoffatom oder beide Wasserstoffatome durch organische Radikale ersetzt sind, angesehen werden können.
Eigenschaften
Organische Peroxide können sich bei normalen oder erhöhten Temperaturen exotherm zersetzen. Die Zersetzung kann durch Wärme, Kontakt mit Verunreinigungen (z. B. Säuren, Schwermetallverbindungen, Amine), Reibung oder Stoss ausgelöst werden. Die Zersetzungsgeschwindigkeit nimmt mit der Temperatur zu und ist abhängig von der Zusammensetzung des organischen Peroxids. Bei der Zersetzung können sich schädliche oder entzündliche Gase oder Dämpfe entwickeln. Für bestimmte organische Peroxide ist eine Temperaturkontrolle während der Beförderung erforderlich. Bestimmte organische Peroxide können sich vor allem unter Einschluss explosionsartig zersetzen. Diese Eigenschaft kann durch Hinzufügen von Verdünnungsmitteln oder die Verwendung geeigneter Verpackungen verändert werden. Viele organische Peroxide brennen heftig. Es ist zu vermeiden, dass organische Peroxide mit den Augen in Berührung kommen. Schon nach sehr kurzer Berührung verursachen bestimmte organische Peroxide ernste Hornhautschäden oder Hautverätzungen.
Bereits klassifizierte organische Peroxide, die bereits zur Beförderung in Verpackungen zugelassen sind, die bereits zur Beförderung in Grosspackmitteln (IBC) zugelassen sind, oder die bereits zur Beförderung in Tanks zugelassen sind. Für jeden aufgeführten zugelassenen Stoff ist die Gattungseintragung aus Kapitel 3.2 Tabelle A (UN-Nummern 3101 bis 3120) zugeordnet und sind die entsprechenden Nebengefahren und Bemerkungen mit relevanten Informationen für die Beförderung angegeben.
Diese Gattungseintragungen geben an:
- den Typ (B bis F) des organischen Peroxids;
- den Aggregatzustand (flüssig/fest) und
- gegebenenfalls die Temperaturkontrolle.
Gemische dieser Zubereitungen können dem Typ des organischen Peroxids, der dem gefährlichsten Bestandteil entspricht, gleichgestellt und unter den für diesen Typ geltenden Beförderungsbedingungen befördert werden. Wenn jedoch zwei stabile Bestandteile ein thermisch weniger stabiles Gemisch bilden können, so ist die Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) des Gemisches zu bestimmen und, falls erforderlich, die aus der SADT nach den Vorschriften berechnete Kontroll- und Notfalltemperatur anzugeben.
Gefahrgut der Klasse 5.2 umfasst „organische Peroxide“. Diese Stoffe sind chemisch instabil und können bei unsachgemässem Umgang, Lagerung oder Transport eine Reihe ernsthafter Gefahren darstellen. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 5.2 ausgehen:
- Explosionsgefahr:
- Styroporrelation: Organische Peroxide können leicht explodieren, insbesondere bei Erhitzung oder bei mechanischem Stress, z. B. durch Stoss oder Druck. Diese Stoffe sind oft sehr empfindlich gegenüber Temperaturänderungen.
- Massenexplosion: In entsprechend grossen Mengen können organische Peroxide bei einer instabilen Reaktion zu massiven Explosionen führen.
- Brandgefahr:
- Brennende Eigenschaften*: Organische Peroxide sind häufig stark entzündlich und können bei Kontakt mit brennbaren Materialien Brände auslösen oder bestehende Brände intensivieren.
- Reaktionsfreudigkeit: Diese Stoffe können die Kauffähigkeit von brennbaren Materialien erhöhen und beim Brand schnell zu einer Conflagration führen.
- Chemische Reaktivität:
- Reaktionen mit anderen Chemikalien: Organische Peroxide können heftig mit vielen anderen Chemikalien reagieren, was gefährliche und oft unvorhersehbare Reaktionen hervorrufen kann.
- Thermische Zersetzung: Bei hoher Temperatur können organische Peroxide zerfallen und dabei gefährliche Gase freisetzen.
- Toxische Dämpfe:
- Gesundheitsrisiken: Bei der Verbrennung oder Zersetzung können toxische und gesundheitsschädliche Dämpfe oder Gase freigesetzt werden, die beim Einatmen ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen können.
- Reizungen: Organische Peroxide können Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen verursachen.
- Umweltschäden:
- Verschmutzung: Bei einem Accident oder einer Leckage können organische Peroxide in die Umwelt gelangen und dort Boden, Wasserquellen und Ökosysteme schädigen.
- Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:
- Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung organischer Peroxide müssen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen. Unsachgemässe Lagerung oder Handhabung kann die Gefahr eines Vorfalls erheblich erhöhen.
- Erforderliche Lagerbedingungen: Diese Stoffe sollten unter kontrollierten Temperaturen gelagert werden, um die Risiken von Selbstentzündung oder explosiven Reaktionen zu minimieren.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 5.2 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung:
Personen, die mit organischen Peroxiden arbeiten, müssen gründlich geschult werden, um die Risiken zu verstehen und geeignete Verfahren einzuhalten. - Einhaltung von Vorschriften:
Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt beachtet werden. - Geeignete Lagerung:
Organische Peroxide sollten in speziellen, dafür geeigneten Behältern aufbewahrt werden und von Zündquellen sowie anderen gefährlichen Stoffen ferngehalten werden. - Brandverhütung:
Entsprechende Massnahmen zur Brandverhütung sollten ergriffen werden, einschliesslich der Bereitstellung von Feuerlöschgeräten und -systemen. - Einsatz von Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung, wie schützende Kleidung, Handschuhe und Atemschutz, sollte immer getragen werden, um den Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 5.2 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Menschen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.
-
Klasse 6.1 – Giftige Stoffe
Der Begriff der Klasse 6.1
umfasst Stoffe, von denen aus der Erfahrung bekannt oder nach tierexperimentellen Untersuchungen anzunehmen ist, dass sie bei einmaliger oder kurzdauernder Einwirkung in relativ kleiner Menge beim Einatmen, bei Absorption durch die Haut oder Einnahme zu Gesundheitsschäden oder zum Tode eines Menschen führen können.
Anmerkung:
- Genetisch veränderte Mikroorganismen und Organismen sind dieser Klasse zuzuordnen, wenn sie deren Bedingungen erfüllen.
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 6.1 sind wie folgt unterteilt:
- T Giftige Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- T1 organische flüssige Stoffe
- T2 organische feste Stoffe
- T3 metallorganische Stoffe
- T4 anorganische flüssige Stoffe
- T5 anorganische feste Stoffe
- T6 Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide), flüssig
- T7 Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide), fest
- T8 Proben
- T9 sonstige giftige Stoffe
- T10 Gegenstände
- TF Giftige entzündbare Stoffe und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- TF1 flüssige Stoffe
- TF2 flüssige Stoffe, die als Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide) verwendet werden
- TF3 feste Stoffe
- TF4 Gegenstände
- TS Giftige selbsterhitzungsfähige feste Stoffe
- TW Giftige Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase bilden
- TW1 flüssige Stoffe
- TW2 feste Stoffe
- TO Giftige entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
- TO1 flüssige Stoffe
- TO2 feste Stoffe
- TC Giftige ätzende Stoffe und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- TC1 organische flüssige Stoffe
- TC2 organische feste Stoffe
- TC3 anorganische flüssige Stoffe
- TC4 anorganische feste Stoffe
- TC5 Gegenstände
- TFC Giftige entzündbare ätzende Stoffe
- TFW Giftige entzündbare Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase bilden.
Begriffsbestimmungen
Für Zwecke des ADR gilt:
- LD50-Wert (mittlere tödliche Dosis) für die akute Giftigkeit bei Einnahme ist die statistisch abgeleitete Einzeldosis eines Stoffes, bei der erwartet werden kann, dass innerhalb von 14 Tagen bei oraler Einnahme der Tod von 50 Prozent junger ausgewachsener Albino-Ratten herbeigeführt wird. Der LD50-Wert wird in Masse Prüfsubstanz zu Masse Versuchstier (mg/kg) ausgedrückt.
- LD50-Wert für die akute Giftigkeit bei Absorption durch die Haut ist diejenige Menge, die bei kontinuierlichem Kontakt während 24 Stunden mit der nackten Haut von Albino-Kaninchen mit der grössten Wahrscheinlichkeit den Tod der Hälfte der Tiergruppe innerhalb von 14 Tagen herbeiführt. Die Anzahl Tiere, die diesem Versuch unterworfen wird, muss genügend gross sein, damit das Ergebnis statistisch signifikant ist und den guten Gepflogenheiten der Pharmakologie entspricht. Das Ergebnis wird in mg je kg Körpermasse ausgedrückt.
- LC50-Wert für die akute Giftigkeit beim Einatmen ist diejenige Konzentration von Dampf, Nebel oder Staub, die bei kontinuierlichem Einatmen während einer Stunde durch junge, erwachsene männliche und weibliche Albino-Ratten mit der grössten Wahrscheinlichkeit den Tod der Hälfte der Tiergruppe innerhalb von 14 Tagen herbeiführt. Ein fester Stoff muss einer Prüfung unterzogen werden, wenn die Gefahr gegeben ist, dass mindestens 10 % seiner Gesamtmasse aus Staub besteht, der eingeatmet werden kann, z. B. wenn der aerodynamische Durchmesser dieser Partikelfraktion höchstens 10 μm beträgt. Ein flüssiger Stoff muss einer Prüfung unterzogen werden, wenn die Gefahr gegeben ist, dass bei einer Undichtigkeit der für die Beförderung verwendeten Umschliessung Nebel entsteht. Sowohl bei den festen als auch bei den flüssigen Stoffen müssen mehr als 90 Masse-% einer für die Prüfung vorbereiteten Probe aus Partikeln bestehen, die, wie oben beschrieben, eingeatmet werden können. Das Ergebnis wird in mg je Liter Luft für Staub und Nebel und in ml je m3 Luft (ppm) für Dampf ausgedrückt.
Gefahrgut der Klasse 6.1 umfasst „toxische Stoffe“, die bei Kontakt mit Menschen oder Tieren erhebliche Gesundheitsrisiken darstellen können. Diese Stoffe sind in der Lage, akute oder chronische Vergiftungen hervorzurufen. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 6.1 ausgehen:
- Toxizität:
- Gesundheitsrisiken: Toxische Stoffe können bereits in geringen Mengen gefährlich sein und beim Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt akute Vergiftungen verursachen. Symptome können von Reizungen der Atemwege bis zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen oder sogar zum Tod reichen.
- Langzeitfolgen: Einige toxische Stoffe können chronische gesundheitliche Auswirkungen haben, wie Schäden an Organen, Krebs oder andere schwerwiegende Erkrankungen, die sich über einen längeren Zeitraum entwickeln.
- Erscheinungsformen:
Feststoffe, Flüssigkeiten oder Gase: Toxische Stoffe der Klasse 6.1 können in verschiedenen Formen auftreten, und ihre Gefahren variieren je nach dieser Erscheinungsform. Gase können insbesondere bei unzureichender Belüftung schnell zu einer tödlichen Gefahr werden. - Umweltgefahren:
- Verschmutzung: Bei Leckagen oder Unfällen können toxische Stoffe in die Umwelt gelangen und schwere Schäden an Böden, Gewässern und Ökosystemen verursachen. Die Umweltverschmutzung kann zu weitreichenden ökologischen Schäden führen.
- Langfristige Auswirkungen: Die Einschleppung toxischer Chemikalien in die Umwelt kann auch langfristige Folgen für Flora und Fauna haben, einschliesslich der Kontamination von Trinkwasserquellen.
- Sicherheitsrisiken bei Transport und Lagerung:
- Unsachgemässes Handling:Es kann zu unbeabsichtigten Leckagen oder Kontaminationen kommen, die sowohl für Mensch als auch Umwelt eine Gefahr darstellen können.
- Lagerbedingungen: Toxische Stoffe erfordern besondere Lagerbedingungen, um das Risiko von Unfällen und Exposition zu minimieren.
- Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 6.1 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit toxischen Stoffen umgehen, sollten gründlich geschult werden, um die Risiken zu verstehen und geeignete Verfahren zur Handhabung befolgen zu können.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe sollten strikt beachtet werden.
- Geeignete Lagerung: Toxische Stoffe sollten in speziellen, dafür geeigneten Behältern aufbewahrt und von Zündquellen sowie anderen gefährlichen Materialien ferngehalten werden.
- Schutzausrüstung: Persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Atemschutz und Schutzbrillen, sollte verwendet werden, um den direkten Kontakt mit toxischen Stoffen zu verhindern.
- Sicherheitsdatenblätter (SDB): Diese sollten jederzeit verfügbar sein, um Informationen über die Handhabung, die Gefahren, die Herstellung von Erste-Hilfe-Massnahmen und Notfallmassnahmen zu liefern.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 6.1 besondere Sorgfalt und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Personen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.
-
Klasse 6.2 – Ansteckungsgefährliche Stoffe
Der Begriff der Klasse 6.2
umfasst ansteckungsgefährliche Stoffe. Ansteckungsgefährliche Stoffe im Sinne des ADR sind Stoffe, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger enthalten. Krankheitserreger sind Mikroorganismen (einschliesslich Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze) und andere Erreger wie Prionen, die bei Menschen oder Tieren Krankheiten hervorrufen können.
Anmerkung:
- Genetisch veränderte Mikroorganismen und Organismen, biologische Produkte, diagnostische Proben und absichtlich infizierte lebende Tiere sind dieser Klasse zuzuordnen, wenn sie deren Bedingungen erfüllen.
Die Beförderung nicht absichtlich oder auf natürliche Weise infizierter lebender Tiere unterliegt nur den relevanten Rechtsvorschriften der jeweiligen Ursprungs-, Transit- und Bestimmungsländer. - Toxine aus Pflanzen, Tieren oder Bakterien, die keine ansteckungsgefährlichen Stoffe oder Organismen enthalten oder die nicht in ansteckungsgefährlichen Stoffen oder Organismen enthalten sind, sind Stoffe der Klasse 6.1 UN-Nummer 3172 oder 3462.
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe der Klasse 6.2 sind wie folgt unterteilt:
- I1 Ansteckungsgefährliche Stoffe, gefährlich für Menschen
- I2 Ansteckungsgefährliche Stoffe, gefährlich nur für Tiere
- I3 Klinische Abfälle
- I4 Biologische Stoffe
Kategorie A:
Ein ansteckungsgefährlicher Stoff, der in einer solchen Form befördert wird, dass er bei einer Exposition bei sonst gesunden Menschen oder Tieren eine dauerhafte Behinderung oder eine lebensbedrohende oder tödliche Krankheit hervorrufen kann. Beispiele für Stoffe, die diese Kriterien erfüllen, sind in der Tabelle dieses Absatzes aufgeführt.
Anmerkung:
Eine Exposition erfolgt, wenn ein ansteckungsgefährlicher Stoff aus der Schutzverpackung austritt und zu einem physischen Kontakt mit Menschen oder Tieren führt.
- Ansteckungsgefährliche Stoffe, die diese Kriterien erfüllen und die bei Menschen oder sowohl bei Menschen als auch bei Tieren eine Krankheit hervorrufen können, sind der UN-Nummer 2814 zuzuordnen. Ansteckungsgefährliche Stoffe, die nur bei Tieren eine Krankheit hervorrufen können, sind der UN-Nummer 2900 zuzuordnen.
- Die Zuordnung zur UN-Nummer 2814 oder 2900 hat auf der Grundlage der bekannten Anamnese und Symptome des erkrankten Menschen oder Tieres, der lokalen endemischen Gegebenheiten oder der Einschätzung eines Spezialisten bezüglich des individuellen Zustands des erkrankten Menschen oder Tieres zu erfolgen.
Anmerkung:
Die offizielle Benennung für die Beförderung der UN-Nummer 2814 lautet „ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN“. Die offizielle Benennung für die Beförderung der UN-Nummer 2900 lautet „ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE“.
Die nachfolgende Tabelle ist nicht vollständig. Ansteckungsgefährliche Stoffe, einschliesslich neue oder auftauchende Krankheitserreger, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, die jedoch dieselben Kriterien erfüllen, sind der Kategorie A zuzuordnen. Darüber hinaus ist ein Stoff in die Kategorie A aufzunehmen, wenn Zweifel darüber bestehen, ob dieser die Kriterien erfüllt oder nicht.UN 2814 ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN:
- Bacillus anthracis (nur Kulturen)
- Brucella abortus (nur Kulturen)
- Brucella melitensis (nur Kulturen)
- Brucella suis (nur Kulturen)
- Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Rotz (nur Kulturen)
- Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (nur Kulturen)
- Chlamydia psittaci – aviäre Stämme (nur Kulturen)
- Clostridium botulinum (nur Kulturen)
- Coccidioides immitis (nur Kulturen)
- Coxiella burnetii (nur Kulturen)
- Virus des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers
- Dengue-Virus (nur Kulturen)
- Virus der östlichen Pferde-Encephalitis (nur Kulturen)
- Escherichia coli, verotoxigen (nur Kulturen) a)
- Ebola-Virus
- Flexal-Virus
- Francisella tularensis (nur Kulturen)
- Guanarito-Virus
- Hantaan-Virus
- Hanta-Virus, das hämorrhagisches Fieber mit Nierensyndrom hervorruft
- Hendra-Virus
- Hepatitis-B-Virus (nur Kulturen)
- Herpes-B-Virus (nur Kulturen)
- humanes Immundefizienz-Virus (nur Kulturen)
- hoch pathogenes Vogelgrippe-Virus (nur Kulturen)
- japanisches Encephalitis-Virus (nur Kulturen)
- Junin-Virus
- Kyasanur-Waldkrankheit-Virus
- Lassa-Virus
- Machupo-Virus
- Marburg-Virus
- Affenpocken-Virus (nur Kulturen)
- Mycobacterium tuberculosis (nur Kulturen) a)
- Nipah-Virus
- Virus des hämorrhagischen Omsk-Fiebers
- Polio-Virus (nur Kulturen)
- Tollwut-Virus (nur Kulturen)
- Rickettsia prowazekii (nur Kulturen)
- Rickettsia rickettsii (nur Kulturen)
- Rifttal-Fiebervirus (nur Kulturen)
- Virus der russischen Frühsommer-Encephalitis (nur Kulturen)
- Sabia-Virus
- Shigella dysenteriae type 1 (nur Kulturen) a)
- Zecken-Encephalitis-Virus (nur Kulturen)
- Pocken-Virus
- Virus der Venezuela-Pferde-Encephalitis (nur Kulturen)
- West-Nil-Virus (nur Kulturen)
- Gelbfieber-Virus (nur Kulturen)
- Yersinia pestis (nur Kulturen)
UN 2900 ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, nur GEFÄHRLICH FÜR TIERE:
- Virus der afrikanischen Schweinepest (nur Kulturen)
- aviäres Paramyxovirus Typ 1 – velogenes Newcastle-Disease-Virus (nur Kulturen)
- klassisches Schweinepest-Virus (nur Kulturen)
- Maul- und Klauenseuche-Virus (nur Kulturen)
- Virus der Dermatitis nodularis (lumpy skin disease) (nur Kulturen)
- Mycoplasma mycoides – Erreger der infektiösen bovinen Pleuropneumonie (nur Kulturen)
- Kleinwiederkäuer-Pest-Virus (nur Kulturen)
- Rinderpest-Virus (nur Kulturen)
- Schafpocken-Virus (nur Kulturen)
- Ziegenpocken-Virus (nur Kulturen)
- Virus der vesikulären Schweinekrankheit (nur Kulturen)
- vesikuläres Stomatitis-Virus (nur Kulturen)
Gefahrgut der Klasse 6.2 umfasst „ansteckungsgefährliche Stoffe“, die Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten enthalten, die bei Menschen oder Tieren Krankheiten verursachen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 6.2 ausgehen:
- Ansteckungsgefahr:
- Übertragung von Krankheiten: Ansteckungsgefährliche Stoffe können infektiöse Erreger enthalten, die durch direkten Kontakt, Inhalation, Verschlucken oder andere Wege übertragen werden können. Diese Erreger können zu ernsthaften Erkrankungen führen, einschliesslich Lebensmittelvergiftungen, Atemwegserkrankungen und anderen ansteckenden Krankheiten.
- Verbreitung von Infektionen:
- Kontamination: Diese Stoffe können bei unsachgemässer Handhabung oder Transport die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass gefährliche Mikroben freigesetzt werden. Dies kann zu einer Kontamination von Oberflächen, Wasser oder Nahrungsmitteln führen.
- Schnelle Ausbreitung: Infektiöse Erreger können in bestimmten Umständen sehr schnell verbreitet werden, was eine Gesundheitskrise hervorrufen kann, insbesondere in geschlossenen Gemeinschaften oder Einrichtungen.
- Gesundheitsrisiken:
- Ernsthafte Gesundheitsprobleme: Die Exposition gegenüber ansteckungsgefährlichen Stoffen kann zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen, einschliesslich akuter und chronischer Erkrankungen, die potenziell tödlich sein können.
- Besondere Vulnerabilität: Bestimmte Personengruppen, wie ältere Menschen, schwangere Frauen oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem, sind besonders anfällig für die Auswirkungen ansteckungsgefährlicher Stoffe.
- Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:
- Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung ansteckungsgefährlicher Stoffe müssen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um Risiken für Personen und die Umwelt zu minimieren.
- Klare Kennzeichnung und Dokumentation: Ansteckungsgefährliche Stoffe müssen deutlich gekennzeichnet sein, und alle Transporte müssen ordnungsgemäss dokumentiert werden, um die Sicherheit und den ordnungsgemässen Umgang zu gewährleisten.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 6.2 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit ansteckungsgefährlichen Stoffen umgehen, sollten gründlich geschult werden, um die Risiken zu verstehen und sichere Handhabungsverfahren anzuwenden.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt beachtet werden.
- Geeignete Lagerbedingungen: Ansteckungsgefährliche Stoffe sollten in speziellen, dafür geeigneten Behältern gelagert werden, um eine Kontamination und Gefährdung zu verhindern.
- Einsatz von Schutzausrüstung: Es sollte geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden, um den Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren, einschliesslich Handschuhe, Gesichtsschutz und Atemschutz.
- Notfallpläne: Vorgehen für den Fall eines Unfalls oder einer Kontamination sollten vorhanden und allen Mitarbeitern bekannt sein, um schnell und effektiv reagieren zu können.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 6.2 besondere Sorgfalt und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Personen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.
- Genetisch veränderte Mikroorganismen und Organismen, biologische Produkte, diagnostische Proben und absichtlich infizierte lebende Tiere sind dieser Klasse zuzuordnen, wenn sie deren Bedingungen erfüllen.
-
Klasse 7 – Radioaktive Stoffe
Radioaktive Stoffe
sind Stoffe, die Radionuklide enthalten, bei denen sowohl die Aktivitätskonzentration als auch die Gesamtaktivität je Sendung festgelegte Werte übersteigt.
Radioaktive Stoffe sind Materialien, die instabile Atomkerne enthalten und die Fähigkeit besitzen, ionisierende Strahlung abzugeben. Diese Strahlung kann in Form von Alpha-, Beta- oder Gammastrahlung auftreten und entstehen, wenn sich die Atomkerne von radioaktiven Isotopen in stabilere Formen umwandeln. Hier sind einige wichtige Aspekte zu radioaktiven Stoffen:
- Arten von Strahlung:
- Alpha-Strahlung: Diese besteht aus Heliumkernen und hat eine geringe Penetrationsfähigkeit. Alpha-Partikel können nicht durch die menschliche Haut eindringen, sind aber gefährlich, wenn sie in den Körper gelangen.
- Beta-Strahlung: Diese besteht aus Elektronen oder Positronen und hat eine höhere Penetrationskraft als Alpha-Strahlung, kann aber durch eine dünne Schicht von Material wie Aluminium gestoppt werden.
- Gamma-Strahlung: Diese ist eine Form hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung, die eine hohe Penetrationsfähigkeit aufweist und nur durch dichte Materialien wie Blei oder dicke Betonwände abgeschirmt werden kann.
- Ursachen für Radioaktivität:
- Natürliche Herkunft: Viele radioaktive Stoffe sind natürlich vorkommend, wie Uran, Thorium und Radon. Diese Stoffe können in Gesteinen, Mineralien und sogar im Boden vorkommen.
- Künstliche Herkunft: Radioaktive Isotope können auch künstlich erzeugt werden, zum Beispiel in Kernkraftwerken, Teilchenbeschleunigern oder Forschungseinrichtungen. Ein bekanntes Beispiel ist Cobalt-60, das in der Medizin und Industrie verwendet wird.
- Verwendung radioaktiver Stoffe:
- Medizin: Radioaktive Stoffe werden in der Krebsbehandlung (z. B. Strahlentherapie), in bildgebenden Verfahren (z. B. PET-Scans) und als Tracer in der Diagnostik eingesetzt.
- Energie: In Kernkraftwerken wird die Wärme, die aus der Kernspaltung von Uran- oder Plutonium-Isotopen freigesetzt wird, zur Stromerzeugung genutzt.
- Industrielle Anwendungen: Radioaktive Isotope werden in der industriellen Radiographie, Materialprüfung und zur Sterilisation von Medizinprodukten eingesetzt.
- Risiken und Sicherheitsvorkehrungen:
- Gesundheitsrisiken: Der Kontakt mit radioaktiven Stoffen kann gesundheitliche Schäden verursachen, darunter Strahlenerkrankungen, langfristige DNA-Schäden und ein erhöhtes Krebsrisiko. Die Gefährlichkeit hängt von der Art der Strahlung, der Dosis und der Expositionsdauer ab.
- Schutzmassnahmen: Der Umgang mit radioaktiven Stoffen erfordert strenge Sicherheitsvorkehrungen sowie geeignete Schutzmassnahmen wie Verwendung von Bleischürzen, Abschirmungen und Dosimetern, um die Strahlenexposition zu kontrollieren.
- Regulierung:
- Die Verwendung, Lagerung und der Transport radioaktiver Stoffe unterliegen strengen gesetzlichen Regelungen, die von nationalen und internationalen Organisationen, einschliesslich der International Atom Energy Agency (IAEA), festgelegt werden, um die Sicherheit von Menschen und der Umwelt zu gewährleisten.
Insgesamt sind radioaktive Stoffe wertvolle Materialien, die in vielen Bereichen eingesetzt werden, aber sie erfordern einen verantwortungsvollen Umgang und umfassende Sicherheitsvorkehrungen, um potenzielle Gesundheitsrisiken zu minimieren.
- Arten von Strahlung:
-
Klasse 8– Ätzende Stoffe
Ätzende Stoffe
sind Stoffe, die durch chemische Einwirkung eine irreversible Schädigung der Haut verursachen oder beim Freiwerden materielle Schäden an anderen Gütern oder Transportmitteln herbeiführen oder sie sogar zerstören. Unter den Begriff dieser Klasse fallen auch Stoffe, die erst bei Vorhandensein von Wasser einen ätzenden flüssigen Stoff oder in Gegenwart von natürlicher Luftfeuchtigkeit ätzende Dämpfe oder Nebel bilden.
- Hautätzung:
Für Stoffe und Gemische, die ätzend für die Haut sind, sind allgemeine Zuordnungskriterien gegeben. Die Ätzwirkung auf die Haut bezieht sich auf die Verursachung einer irreversiblen Schädigung der Haut, und zwar eine sichtbare Nekrose durch die Epidermis und in die Dermis, die nach Exposition gegenüber einem Stoff oder einem Gemisch auftritt. - Metallkorrosion bestimmter Stoffe:
Bei flüssigen Stoffen und festen Stoffen, die sich während der Beförderung verflüssigen können, von denen angenommen wird, dass sie nicht ätzend für die Haut sind, ist dennoch die Korrosionswirkung auf bestimmte Metalloberflächen zu berücksichtigen.
Unterteilung nach Eigenschaften
Die Stoffe und Gegenstände der Klasse 8 sind wie folgt unterteilt:
- C1–C11 Ätzende Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- C1–C4 Stoffe sauren Charakters
- C1 anorganische flüssige Stoffe
- C2 anorganische feste Stoffe
- C3 organische flüssige Stoffe
- C4 organische feste Stoffe
- C5–C8 Stoffe basischen Charakters
- C5 anorganische flüssige Stoffe
- C6 anorganische feste Stoffe
- C7 organische flüssige Stoffe
- C8 organische feste Stoffe
- C9–C10 Sonstige ätzende Stoffe
- C9 flüssige Stoffe
- C10 feste Stoffe
- C11 Gegenstände
- C1–C4 Stoffe sauren Charakters
- CF Ätzende entzündbare Stoffe
- CF1 flüssige Stoffe
- CF2 feste Stoffe
- CS Ätzende selbsterhitzungsfähige Stoffe
- CS1 flüssige Stoffe
- CS2 feste Stoffe
- CW Ätzende Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
- CW1 flüssige Stoffe
- CW2 feste Stoffe
- CO Ätzende entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
- CO1 flüssige Stoffe
- CO2 feste Stoffe
- CT Ätzende giftige Stoffe und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten
- CT1 flüssige Stoffe
- CT2 feste Stoffe
- CT3 Gegenstände
- CFT Ätzende entzündbare giftige flüssige Stoffe
- COT Ätzende entzündend (oxidierend) wirkende giftige Stoffe.
Einteilung II:
VG Einwirkungszeit Beobachtungszeitraum Auswirkungen
I ≤ 3 min ≤ 60 min. irreversible Schädigung des unverletzten Hautgewebes
II > 3 min ≤ 1 h ≤ 14 Tage irreversible Schädigung des unverletzten Hautgewebes
III > 1 h ≤ 4 h ≤ 14 Tage irreversible Schädigung des unverletzten Hautgewebes
III Korrosionsrate auf Stahl- oder Aluminiumoberflächen, die bei einer Prüftemperatur von 55 °C den Wert von 6,25 mm pro Jahr überschreitet, wenn die Stoffe an beiden Werkstoffen geprüft wurden
Gefahrgut der Klasse 8 umfasst „ätzende Stoffe“, die erhebliche Gefahren für Menschen, Tiere und die Umwelt darstellen können. Diese Stoffe können durch chemische Reaktionen Haut, Augen, Atemwege und andere Körpergewebe schädigen. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 8 ausgehen:
- Ätzwirkung:
- Verätzungen: Ätzende Stoffe können bei Hautkontakt ernsthafte Verätzungen und Gewebeschäden verursachen. Dies kann zu Schmerzen, Schwellungen und bleibenden Narben führen.
- Augenschäden: Der Kontakt mit ätzenden Stoffen kann zu schweren Augenverletzungen bis hin zu dauerhaften Sehstörungen oder Blindheit führen. Daher ist Schutz der Augen bei der Handhabung dieser Stoffe entscheidend.
- Atemwegsschäden:
- Schädliche Dämpfe: Viele ätzende Stoffe setzen beim Umgang gefährliche Dämpfe oder Gase frei, die die Atemwege reizen und zu Atembeschwerden oder anderen gesundheitlichen Problemen führen können. In einigen Fällen kann dies lebensbedrohlich sein.
- Umweltschäden:
- Verschmutzung: Die Freisetzung von ätzenden Stoffen in die Umwelt, sei es durch Leckagen oder Unfälle, kann schwere Umweltschäden verursachen. Diese Stoffe können Böden und Wasserquellen kontaminieren und die lokale Flora und Fauna schädigen.
- Langfristige Auswirkungen: Die Auswirkungen auf die Umwelt können langanhaltend sein und erfordern möglicherweise aufwendige Sanierungsmassnahmen.
- Reaktivität:
- Chemische Reaktionen: Ätzwirkende Stoffe können mit anderen Materialien reagieren, insbesondere mit organischen Stoffen oder Metallen, was zu gefährlichen Reaktionen führen kann. Dies kann potenziell explosive oder stark exotherme Reaktionen hervorrufen.
- Sicherheitsrisiken während des Transports und der Lagerung:
- Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung ätzender Stoffe erfordern strenge Sicherheitsvorkehrungen. Unsachgemässe Lagerbedingungen oder mangelnde Schulung können die Gefahren erheblich erhöhen.
- Erforderliche Lagerbedingungen: Diese Stoffe sollten in speziellen, dafür geeigneten Behältern gelagert werden und von anderen Chemikalien ferngehalten werden, um das Risiko von Reaktionen zu minimieren.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 8 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit ätzenden Stoffen arbeiten, sollten umfassend geschult werden, um die Risiken zu verstehen und sichere Handhabungsverfahren zu befolgen.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe sollten strikt beachtet werden.
- Geeignete Lagerbedingungen: ätzende Stoffe sollten in speziellen Behältern aufbewahrt werden, die gegen ihre ätzenden Eigenschaften beständig sind.
- Schutzausrüstung: Persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe, Gesichtsschutz und spezielle Schutzkleidung sollte getragen werden, um den Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.
- Notfallpläne: Vorgehen für den Fall eines Unfalls oder einer Kontamination sollten vorhanden sein und allen Mitarbeitern bekannt sein, um schnell und effektiv reagieren zu können.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 8 besondere Sorgfalt und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Personen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.
- Hautätzung:
-
Klasse 9 – Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Unter den Begriff der Klasse 9 fallen
Stoffe und Gegenstände, die während der Beförderung eine Gefahr darstellen, die nicht unter die Begriffe anderer Klassen fällt. Diese sind wie folgt unterteilt:
- M1 Stoffe, die beim Einatmen als Feinstaub die Gesundheit gefährden können
- M2 Stoffe und Gegenstände, die im Brandfall Dioxine bilden können
- M3 Stoffe, die entzündbare Dämpfe abgeben
- M4 Lithiumbatterien und Natrium-Ionen-Batterien
- M5 Rettungsmittel
- M6–M8 Umweltgefährdende Stoffe
- M6 Wasserverunreinigende flüssige Stoffe
- M7 Wasserverunreinigende feste Stoffe
- M8 Genetisch veränderte Mikroorganismen und Organismen
- M9–M10 Erwärmte Stoffe
- M9 flüssige Stoffe
- M10 feste Stoffe
- M11 Andere Stoffe und Gegenstände, die während der Beförderung eine Gefahr darstellen und nicht unter die Begriffsbestimmung einer anderen Klasse fallen.
Gefahrgut der Klasse 9 umfasst „sonstige gefährliche Stoffe und Gegenstände“, die nicht in die anderen Klassen eingeordnet werden können, aber dennoch potenzielle Gefahren für Menschen, die Umwelt oder Sachwerte darstellen. Diese Klasse umfasst eine Vielzahl von Materialien, die verschiedene Arten von Risiken mit sich bringen können. Hier sind die wichtigsten Gefahren, die von Stoffen der Klasse 9 ausgehen:
- Verschmutzung der Umwelt:
Umweltgefährdende Stoffe: Viele Stoffe dieser Klasse sind umweltgefährdend und können Gewässer, Boden und die Luft kontaminieren. Dies kann giftige oder schädliche Auswirkungen auf Ökosysteme und die Biodiversität haben. - Reaktivität:
Chemische Reaktionen: Einige Stoffe der Klasse 9 können mit anderen Chemikalien reagieren, was zu unerwarteten und potenziell gefährlichen Reaktionen führen kann. Diese Reaktionen können exotherm sein und damit zusätzliche Risiken verursachen. - Toxische Dämpfe:
Freisetzung von Gasen: Bei der Handhabung oder im Falle eines Unfalls können gefährliche Dämpfe oder Gase freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sein können. Dies kann Atemprobleme und andere gesundheitliche Folgen verursachen. - Sicherheitsrisiken während des Transports:
- Unsachgemässer Umgang: Der Transport und die Lagerung von Materialien der Klasse 9 erfordern spezifische Sicherheitsvorkehrungen. Unsachgemässe Lagerung oder unsachgemässer Umgang können die Gefahr von Unfällen erheblich steigern.
- Kennzeichnung: Obwohl diese Stoffe nicht in andere spezifische Gefahrgutklassen fallen, müssen sie dennoch richtig gekennzeichnet und verpackt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Mischung mit anderen Stoffen:
Risiko bei Mischungen: Einige Stoffe der Klasse 9 können in Kombination mit anderen Gefahrstoffen oder sogar ungiftigen Materialien unerwartete Gefahren hervorrufen.
Sicherheitsmassnahmen
Um die Gefahren von Gefahrgut der Klasse 9 zu minimieren, sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
- Schulung: Personen, die mit diesen Stoffen umgehen, sollten entsprechend geschult werden, um die Risiken zu verstehen und sichere Handhabungsverfahren anzuwenden.
- Einhaltung von Vorschriften: Alle nationalen und internationalen Vorschriften für den Umgang, Transport und die Lagerung dieser Stoffe müssen strikt beachtet werden.
- Geeignete Lagerbedingungen: Material der Klasse 9 sollte in sicheren, geeigneten Behältern gelagert werden und von anderen gefährlichen Materialien ferngehalten werden.
- Einsatz von Schutzausrüstung: Persönliche Schutzausrüstung, wie schützende Kleidung, Handschuhe und Atemschutz, sollte verwendet werden, um den direkten Kontakt mit diesen gefährlichen Stoffen zu minimieren.
Insgesamt erfordert der Umgang mit Gefahrgut der Klasse 9 besondere Aufmerksamkeit und strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die Sicherheit von Personen, die Umwelt und Vermögenswerte zu gewährleisten.
Landverkehre – ADR / RID / ADN
Multilaterale Abkommen - ADR
-
M361 — Gefahrgut in gebrauchten Gegenständen, Maschinen oder Geräten
Österreich ist im März 2025 der multilateralen Vereinbarung M361 beigetreten. Diese Vereinbarung stellt gewisse Erleichterungen für den Transport gefährlicher Güter in gebrauchten Gegenständen, Maschinen oder Geräten zur Verfügung:
Die Vorschriften des ADR müssen nicht auf gebrauchte Gegenstände, Maschinen oder Geräte angewendet werden, die im Inneren möglicherweise mit gefährlichen Gütern kontaminiert sind, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Die gebrauchten Gegenstände, Maschinen oder Geräte werden für Reparatur, Prüfung, Wartung, Entsorgung oder Recycling transportiert.
- Es müssen Massnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass der Inhalt sicher eingeschlossen ist und unter normalen Transportbedingungen ein Austritt des Inhalts verhindert wird.
- Von dieser multilateralen Vereinbarung ausgenommen sind gebrauchte Gegenstände, Maschinen oder Geräte, die gefährliche Güter der Klasse 1 und/oder Klasse 7 enthalten.
Eine Kopie dieser Vereinbarung muss während des Transports mitgeführt werden.
Diese Erleichterung gilt nur bis zum 31. Dezember 2026 für Transporte in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Derzeit (Stand: 7. April 2025) haben nur Deutschland und Österreich diese multilaterale Vereinbarung unterzeichnet, was bedeutet, dass die Erleichterung gegenwärtig nur in Deutschland und Österreich Anwendung findet.Hier der Link zur UNECE Multilaterale Vereinbarungen
-
M354 — Transport von Natrium-Ionen-Batterien
Multilaterales Abkommen M354 gemäss Abschnitt 1.5.1 ADR über den Transport von Natrium-Ionen-Batterien
Das Multilaterale Abkommen M354 ermöglicht den Transport von Natrium-Ionen-Batterien mit organischem Elektrolyten und solchen, die in Geräten enthalten sind oder zusammen mit Geräten transportiert werden, abweichend von bestimmten Vorschriften des ADR. Hier sind die Hauptpunkte des Abkommens:
Transportkategorie: Natrium-Ionen-Batterien, einschliesslich Zellen, können unter den UN-Nummern 3551 (Natrium-Ionen-Batterien mit organischem Elektrolyten) oder 3552 (in Geräten enthalten oder mit Geräten verpackt) transportiert werden, wenn die Bedingungen des Abkommens eingehalten werden.
Klassifizierung: Diese Batterien und Zellen werden als Artikel der Klasse 9 klassifiziert, und der Tunnelbeschränkungscode ist „E“. Besonders relevante Vorschriften des ADR, wie die provisions 188, 230, 310, 348, 376, 377, 384 und 667, gelten ebenfalls.
Verpackung: Verpackungen, die für den Transport verwendet werden, müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, einschliesslich der Verwendung von geeigneten Materialien, und müssen so gestaltet sein, dass sie Unfälle, wie Kurzschlüsse, während des Transports verhindern.
Kennzeichnung: Die Verpackungen müssen entsprechend gekennzeichnet werden, wobei die Gefahrgutkennzeichnung gemäss Modell 9A verwendet wird. Alle anderen relevanten Vorschriften des ADR sind ebenfalls einzuhalten.
Befreiungen von anderen Vorschriften: Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien, die in Geräten enthalten oder zusammen mit Geräten verpackt sind, unterliegen nicht den anderen Bestimmungen des ADR, solange sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Gültigkeit: Dieses Abkommen ist bis zum 30. Juni 2025 für den Transport in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien gültig, die dieses Abkommen unterzeichnet haben. Sollten Änderungen bevor dieser Termin von einem der Unterzeichner vorgenommen werden, bleibt es bis zum genannten Datum für die Vertragsparteien gültig, die es nicht widerrufen haben.
Diese Zusammenfassung bietet einen Überblick über die Hauptinhalte des Abkommens M354 in Bezug auf den Transport von Natrium-Ionen-Batterien und deren spezifische Anforderungen.Hier der Link zur UNECE Multilaterale Vereinbarungen
-
M347 — Affenpockenvirus
Das Multilaterale Abkommen M347 erlaubt abweichend von bestimmten Bestimmungen des ADR den Transport von infektiösen Substanzen, die das Affenpockenvirus enthalten, mit den UN-Nummern 3373 oder 3291, es sei denn, es handelt sich um Kulturen des Affenpockenvirus. Der Versender muss im Transportdokument vermerken: „Transport gemäss dem Multilateralen Abkommen M347“. Dieses Abkommen ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig für Transporte in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die dieses Abkommen unterzeichnet haben. Sollte es vor diesem Datum von einem der Unterzeichner widerrufen werden, bleibt es nur in den Hoheitsgebieten der Vertragsparteien gültig, die das Abkommen nicht widerrufen haben.
Hier der Link zur UNECE Multilaterale Vereinbarungen
-
M329 — Transport bestimmter Abfälle, die gefährliche Güter enthalten
Multilaterales Abkommen M329 gemäss Abschnitt 1.5.1 ADR über den Transport bestimmter Abfälle, die gefährliche Güter enthalten
1. Einführung
Dieses Abkommen gilt ausschliesslich in Verbindung mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen im Einklang mit dem geltenden Abfallrecht. Abweichend von den Bestimmungen des ADR ist der Transport von Abfällen, die gefährliche Güter enthalten oder selbst als gefährliche Güter gelten, unter den Bedingungen der Abschnitte 2 bis 8 dieses Abkommens erlaubt. Allerdings findet das Abkommen keine Anwendung auf Abfälle der folgenden Klassen:
a) Klasse 1
b) Klasse 6.2
c) Klasse 7
d) Klasse 2, die als giftig gekennzeichnet sind (Label 2.3 oder 6.1)
e) Klassen 4.1 und 5.2, die eine Temperaturkontrolle erfordern (Klassifizierungscode SR2, PM2 oder P2)
f) Genetisch veränderte Mikroorganismen und Organismen mit UN-Nummer 3245.
2. KlassifizierungVereinfachte Zuordnung: Die Zuordnung nach 2.1.3.5.5 ADR kann auch auf folgende Abfälle angewendet werden:
a) UN 1950 Abfälle von Aerosolen
b) Klassifizierung als flüssige Substanz, wenn die Bildung einer Flüssigphase nicht ausgeschlossen werden kann.
Zusätzlich kann die Klassifizierung als UN 3509 (Packmittel, verworfen, leer, ungewaschen) angewendet werden, wenn die Verpackungen Rückstände enthalten, die nach der ordnungsgemässen Entleerung nicht ohne grösseren Aufwand entfernt werden können.3. Verpackung
Verpackungen dürfen unter bestimmten Abweichungen von den ADR-Bestimmungen verwendet werden, solange ihr Zustand und Inhalt sowie die Art des Transports die Einhaltung der Schutzvorschriften für Verpackungen gemäss Abschnitt 4.1.1 ADR nicht gefährden.
4. Transport in losem Schüttgut
Für den Transport in losem Schüttgut gelten folgende Abweichungen:
UN 1950 Abfälle von Aerosolen dürfen in geschlossenen oder abgedeckten Fahrzeugen oder Behältern transportiert werden, sofern keine ungewollte Entleerung erfolgt.
UN 3509 Packmittel, verworfen, leer, ungewaschen, dürfen unter bestimmten Bedingungen transportiert werden, ohne dass das umweltgefährdende Stoffzeichen erforderlich ist.
5. Transport bestimmter AbfälleEs gibt spezifische Regelungen für den Transport von Maschinen oder Geräten, die gefährliche Güter enthalten, sowie für pharmazeutische Produkte, die nicht mehr für den Verkauf bestimmt sind.
6. Kennzeichnung von Verpackungen
Die Kennzeichnungsvorschriften gemäss Abschnitt 5.2 ADR gelten mit bestimmten Ausnahmen. So dürfen z.B. die umweltgefährdenden Stoffzeichen entfallen.
7. Informationen im Transportdokument
Bestimmungen über die Informationen im Transportdokument gelten mit einigen Abweichungen, darunter das Fehlen der Notwendigkeit einer ergänzenden technischen Bezeichnung.
8. Weitere Bestimmungen
Die Gesamtnettomasse der gefährlichen Güter kann geschätzt werden, es sei denn, der Frachtführer verlangt andere Vorgaben. Alle anderen relevanten Bestimmungen des ADR bleiben anwendbar.
9. Gültigkeitsbereich
Dieses Abkommen ist bis zum 21. September 2025 für den Transport auf den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien gültig, die dieses Abkommen unterzeichnet haben. Wenn es vorher von einem der Unterzeichner aufgehoben wird, bleibt es nur bis zu diesem Datum für die Vertragsparteien gültig, die das Abkommen nicht widerrufen haben.
Hier der Link zur UNECE Multilaterale Vereinbarungen
Infos von der UNECE & der OTIF
-
Muster gültiger ADR-Cards
Oft ist es sehr schwierig herauszufinden, welche ADR-Card, aus welchem Land wirklich echt ist. Deswegen gibt es auf der Webseite der UNECE eine Liste aller gültigen ADR-Cards. Hier ist der Link: https://unece.org/transport/dangerous-goods/adr-certificates#accordion_
-
OTIF verkündet RID-Korrekturen
Im deutschen, englischen und französischen Text der Änderungen zum RID (Anlage zum Anhang C des Übereinkommens), die durch die Depositarnotifikation NOT-RID-24007 vom 24. Juni 2024 bekannt gegeben wurden, wurden mehrere Fehler festgestellt. Die Korrektur dieser Fehler wurde auf der Homepage der OTIF veröffentlicht.

Hochseeschifffahrt – IMO IMDG-Code
-
Neu 2025 im IMDG-Code 42-24
Im IMDG-Code wurden bei den UN-Nummern 0030, 0255, 0456, 0511, 0512 und 0513 die Sondervorschrift 399 ergänzt. Diese Regelung stand bislang nur in Kapitel 3.3, war aber nicht in der Tabelle in Kapitel 3.2 bei den betreffenden UN-Nummern aufgeführt. Neu ist außerdem die Sondervorschrift 409: Die Vorschriften des Kapitels 3.2 der 22. Auflage der Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter können bis zum 31. Dezember 2026 weiterhin angewendet werden. Zurzeit sind in den IMDG-Änderungen keine UN-Nummern 3364 bis 3370 sowie 3376 enthalten, die im Zusammenhang mit der Sondervorschrift 28 stehen.
Zusätzlich enthalten die Einträge für UN 3551 (Natrium-Ionen-Batterien) und UN 3552 (in Geräten oder verpackt mit Geräten) im IMDG-Code die neue Sondervorschrift 384, die vergleichbar ist mit den Regelungen für Lithium-Ionen-Batterien.
Für die Fahrzeuge UN 3556 (mit Lithium-Ionen-Batterien) und UN 3557 (mit Lithium-Metall-Batterien) gilt ebenfalls die neue Sondervorschrift 405. Für UN 3558 sind die Sondervorschriften 404 und 405 vorgesehen:
- Die Vorschrift 404 entspricht den Regelungen im ADR.
Die Vorschrift 405 bestimmt, dass Fahrzeuge nicht den Kennzeichnungs- und Bezettelungsvorschriften des Kapitels 5.2 IMDG-Code unterliegen, sofern sie nicht vollständig durch Verpackungen, Verschläge oder andere Schutzmaßnahmen umschlossen sind, die eine leichte Identifizierung verhindern. Das gleiche gilt für den neuen Absatz e) der Sondervorschrift 666 im ADR.
In den Verpackungsanweisungen wurde außerdem in IBC03 eine neue Sondervorschrift B11 bezüglich UN 2672 (Ammoniaklösung) eingefügt.
In Absatz 5.2.2.1.13, der die Gefahrzettel für Gegenstände behandelt, die gefährliche Güter enthalten, wurden die Natrium-Ionen-Batterien ergänzt. Zudem wurden in Absatz 5.5.3.3.1 die Verpackungsanweisungen P650 und P800 durch die Alternativen P650 oder P800 ersetzt.
Des Weiteren wurde in Unterabschnitt 6.1.3.1 eine neue Bemerkung eingefügt: Die Vorschriften dieses Unterabschnitts der 22. Auflage können bis zum 31. Dezember 2026 weiterhin angewendet werden. Verpackungen, die vor dem 1. Januar 2027 nach den damals geltenden Vorschriften hergestellt wurden, dürfen weiterhin genutzt werden.
Für geschlossene Kryo-Behälter wurde eine neue Bemerkung in 6.2.1.5.2 ergänzt: Behälter, die nach den Vorschriften der 21. Auflage gebaut wurden, aber nicht den Anforderungen der 22. Auflage entsprechen, dürfen weiterhin verwendet werden. Ähnliche Übergangsregelungen gelten auch für die Absätze 6.2.2.7.3 und 6.2.2.11.
Derzeit wird diskutiert, die Sondervorschrift 375, die in den UN-Modellvorschriften enthalten ist, in den IMDG-Code zu integrieren. Ebenso gibt es Bestrebungen, die Sondervorschriften 961 und 962 durch eine neue, allgemeine Sondervorschrift 9xx zu ersetzen, die die verschiedenen Antriebsarten und den Zustand der Fahrzeuge berücksichtigt. Defekte Fahrzeuge werden aktuell in diesem Zusammenhang noch nicht betrachtet.
- Die Vorschrift 404 entspricht den Regelungen im ADR.
Flugverkehr – IATA DGR / ICAO TI
-
Neu im IATA DGR 2025 / Ausgabe 66
Die Luftverkehrsorganisation IATA hat die wichtigsten Änderungen und Ergänzungen der 66. Ausgabe der Gefahrgutvorschriften IATA-DGR zusammengefasst und in englischer Sprache auf ihrer Website veröffentlicht. Laut IATA enthält diese Übersicht alle Änderungen der Ausgabe 2025–2026 der ICAO Technical Instructions sowie die vom IATA-Gefahrgutausschuss beschlossenen Anpassungen.
Die Änderungen betreffen vorrangig die folgenden Abschnitte und Kapitel:
- 1.2.7 – Ausnahmen für Datenlogger und Frachtverfolgungssysteme
- 2.3 – Gefährliche Güter, mitgeführt von Passagieren oder Crew
- 2.8 – Abweichungen der Staaten und Operator
- 3 – Klassifizierung
- 4.2 – Neue Einträge im Verzeichnis der gefährlichen Güter
- 4.4 – Geänderte und neue Sonderbestimmungen
- 5 – Verpackungsanweisungen
- 6.2 – Spezifikationen für UN-Verpackungen
- 6.4 – Bau- und Prüfanforderungen für Flaschen und verschlossene Kryo-Behälter
- 7 – Kennzeichnung von Lithiumbatterien
- 8 – Dokumentation bei UN 3171 und Luftfrachtbrief
- 9 – Annahme-Kontrollliste und Verladung von tiefgekühlten Flüssigkeiten
- 10 – Umverpackungen bei UN 1845
- Mehrere Änderungen in den Anhängen
Hier zum PDF
-
Änderungen im ATA DGR 2025/2026
Die Regeln zu Lithium Batterien werden In jeder Ausgabe der IATA-DGR geändert. Besonders in der 66. Ausgabe fällt auf, dass nun auch Lithium-Ionen-Batterien, die mit Ausrüstung verpackt sind (UN 3481), von Begrenzungen des Ladezustands betroffen sind. Für das Jahr 2025 wird empfohlen, dass Batterien mit einer Nennenergie über 2,7 Wh maximal mit 30 Prozent Ladezustand transportiert werden sollen. Ab 2026 wird diese Empfehlung verpflichtend.
Für Lithium-Ionen-Batterien, die in Ausrüstung verpackt sind und eine Nennenergie bis zu 2,7 Wh aufweisen, gilt ebenfalls die Empfehlung, den Ladezustand auf maximal 30 Prozent (SoC 30 %) zu begrenzen. Alternativ sollte bei Transporten die Batteriekapazität auf nicht mehr als 25 Prozent der Kapazität eingestellt sein.
Für die neuen UN-Nummern UN 3556 (Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien), UN 3557 (Fahrzeuge mit Lithium-Metall-Batterien) und UN 3558 (Fahrzeuge mit Natrium-Ion-Batterien) gilt bis zum 31.03.2025 eine Übergangsvorschrift. Bis dahin können diese Fahrzeuge noch unter dem bisherigen UN 3171 transportiert werden. Für den Transport sollten die Fahrzeuge mit einem Ladezustand ≤ 30 % (SoC 30 %) oder einer Batteriekapazität von höchstens 25 % der Nennkapazität angeboten werden.
Ab dem 01.01.2026 gelten folgende Bedingungen:
Fahrzeuge mit einer Nennenergie über 100 Wh müssen entweder mit einem Ladezustand ≤ 30 % (SoC 30 %) oder mit einer Batteriekapazität von höchstens 25 % der Nennkapazität angeboten werden.
Bei Fahrzeugen mit maximal 100 Wh Nennenergie gelten ebenfalls die gleichen Begrenzungen für Ladezustand und Batteriekapazität.
Fahrzeuge, die Batterien mit mehr als 100 Wh Nennenergie und einem Ladezustand über 30 % betreiben, dürfen nur mit Genehmigung des Herkunfts- sowie des Betriebsstaates unter schriftlich festgelegten Bedingungen befördert werden.Neu eingeführt wird zudem eine Regelung zu Datenloggern und Tracking-Systemen (Abschnitt 1.2.7.1 i)), die während des Fluges genutzt oder dafür vorgesehen sein dürfen. Voraussetzung ist, dass die Lithium-Batterien nach dem Handbuch geprüft und gemäß QM-System hergestellt wurden, mit folgenden Spezifikationen:
- Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien dürfen höchstens 20 Wh Nennenergie haben.
- Lithium-Metall-Zellen und -Batterien dürfen maximal 1 g Lithium enthalten.
Die Geräte dürfen keine gefährliche Hitzeentwicklung aufweisen und müssen den Normen für elektromagnetische Strahlung entsprechen, um Störungen an den Flugzeugsystemen auszuschließen.
Die Anzahl der Geräte darf nur so hoch sein, wie für die Datenerfassung notwendig ist.
Für lithiumbatteriebetriebene Mobilitätshilfen wird eine neue Bemerkung eingeführt: Wenn die Lithiumbatterie(n) in der Mobilitätshilfe verbleiben, besteht keine Wattstunden-Begrenzung.Außerdem muss die Prüfzusammenfassung, die die Herstellersysteme bestätigen, so bereitgestellt werden, dass sie jederzeit zugänglich ist. Gegenstände, die gefährliche Güter enthalten und zusätzlich Lithiumbatterien, müssen bei Nichtprüfung nach UN 38.3 entweder getestet oder als Kleinserie gemäß Sonderbestimmung A88 befördert werden.
-
Abweichungen in der IATA-DGR
Die kürzlich von der IATA veröffentlichten Leitlinien erlauben bestimmte Abweichungen in der Versendererklärung, die grundsätzlich nicht zu einer Ablehnung einer Gefahrgutsendung führen sollten.
Nicht umgesetzte Änderungen im Gefahrgutrecht können dazu führen, das Luftfrachtsendungen an Flughäfen abgelehnt werden, mit negativen Folgen für den Handel und die Wirtschaft. In denen von der IATA (International Air Transport Association) veröffentlichten Leitlinien wurden Abweichungen von der Versendererklärung (IATA-DGR) veröffentlicht, die nicht zu einer Ablehnung führen sollten. Die IATA-Gefahrgutvorschriften und -Prüflisten verweisen darauf, dass die DGD im IATA-Format erstellt wurden. Es besteht die Auffassung, dass die DGD vollständig mit den DGR (Dangerous Goods Declaration) identisch sein müssen. DGR 9.1.3 Anmerkung 4 bezieht sich auf geringfügige Abweichungen und Diskrepanzen, was insbesondere für das Abnahmepersonal von Bedeutung ist, das eine Abnahmecheckliste verwendet.
Geringfügige Abweichungen laut IATA, die sie Sicherheit nicht beeinträchtigen, sind demnach:
- die Verwendung gestrichelter statt durchgezogener Linien;
- die Schriftart oder -größe;
- die Verwendung des Begriffs „risk“ (Risiko) anstelle von „hazard“ (Gefahr).
-
ADDENDUM. 30 April 2025
Die International Air Transport Association (IATA) hat zur 66. Ausgabe ihrer Dangerous Goods Regulations (DGR), die seit Anfang dieses Jahres gültig sind, das Addendum vom 30. April 2025 veröffentlicht.